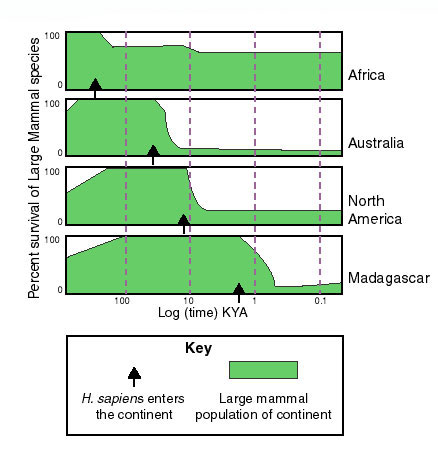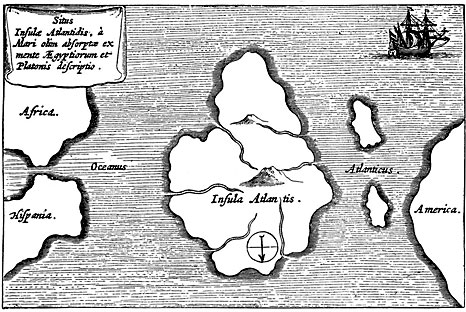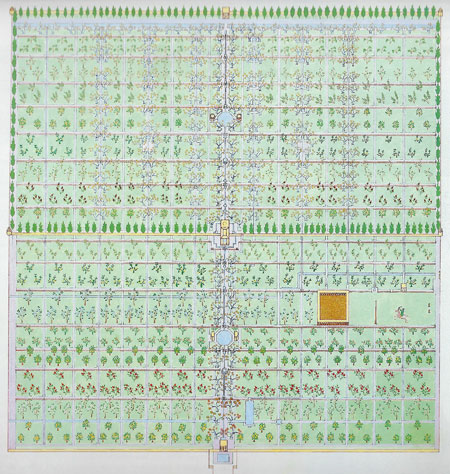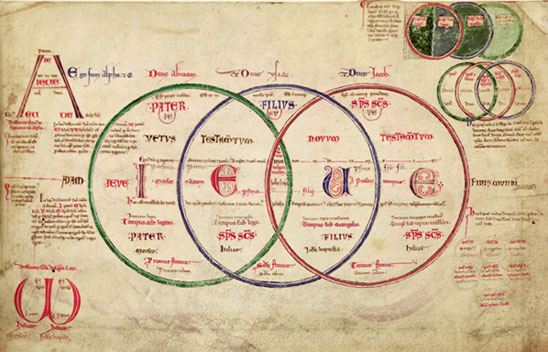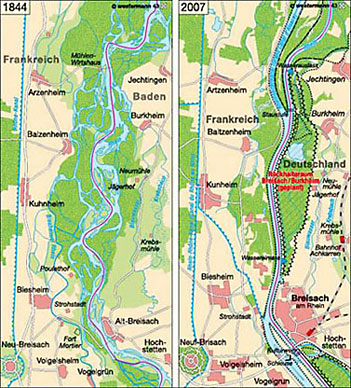|
Die These vom Pleistocene
Overkill
Vielfältig sind die Hinweise auf frühe
menschliche Eingriffe in das Naturgefüge, die
zumindest regional erhebliche Konsequenzen hatten. So
sin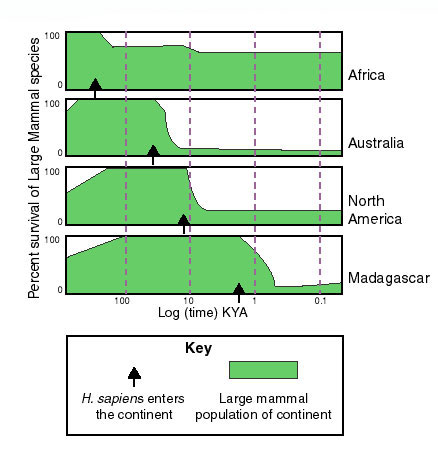 d die
fruchtbaren Lössebenen des Kraichgau nicht nur Ertrag
glazialer Verwehungen aus dem Urstromtal des Rheins,
sondern teilweise auch zurückzuführen auf Entwaldungen
durch die Michaelsberger Kultur, die städtische
Siedlungen in Bereichen anlegte, die heute als
Ausflugsziele mit Kapellen und idyllischen Weinbergen
von Ausflüglern besucht werden. Die entwaldeten Kuppen
wurden in die Täler gespült, das Großwild verschwand,
da es keine Zuflucht mehr hatte. Ähnliches geschah im
Mittelmeerraum, von Platon
in seiner Beschäftigung mit dem Atlantis-Mythos
beschrieben - auch wenn strittig bleibt, ob Platon
selbst dafür auch die menschliche Tätigkeit
verantwortlich machte oder nur Naturkatastrophen am
Werk sah. d die
fruchtbaren Lössebenen des Kraichgau nicht nur Ertrag
glazialer Verwehungen aus dem Urstromtal des Rheins,
sondern teilweise auch zurückzuführen auf Entwaldungen
durch die Michaelsberger Kultur, die städtische
Siedlungen in Bereichen anlegte, die heute als
Ausflugsziele mit Kapellen und idyllischen Weinbergen
von Ausflüglern besucht werden. Die entwaldeten Kuppen
wurden in die Täler gespült, das Großwild verschwand,
da es keine Zuflucht mehr hatte. Ähnliches geschah im
Mittelmeerraum, von Platon
in seiner Beschäftigung mit dem Atlantis-Mythos
beschrieben - auch wenn strittig bleibt, ob Platon
selbst dafür auch die menschliche Tätigkeit
verantwortlich machte oder nur Naturkatastrophen am
Werk sah.
Am
massivsten scheinen die ökologischen Konsequenzen in
Nordamerika gewesen zu sein, wo in der Zeit um 9.000
v. Chr. alle Großsäuger ausstarben. Für dieses
Aussterben, wozu es Parallelen in Südamerika, in
Australien und im nördlichen Eurasien gibt, prägte
Paul Martin, unter Berufung auf Alfred Russel Wallace
("The World of Life", 1911), den Begriff des
"Pleistocene overkill" durch menschliche Jäger.
Konkurrierende Theorien gehen von klimatischen
Veränderungen (präboreale Oszillation) oder
Kometeneinschlägen (die ihrerseits auch
Klimaveränderungen bedingten) als Ursache aus.
Allerdings zeigt der von Surovell, Waguespack und
Brantingham 2005 in einem Paper für die "Proceedings
of the National Academy of Sciences" (26.04.2005)
durchgeführte Vergleich von Daten aus Afrika, Europa,
Asien, Nordamerika und Südamerika eine augenfällige
Korrelation zwischen dem Rückgang der
Großsäugerpopulationen und dem Auftreten des Menschen
- und keine zeitliche Korrelation des Rückgangs auf
den verschiedenen Kontinenten - wie dies bei globalen
klimatischen Veränderungen als Ursache der Fall sein
müsste. Lediglich für einzelne Populationen, wie etwa
der des Mammut, werden bislang überzeugende Belege für
dominierenden, aber keineswegs ausschließlichen,
klimatischen Einfluss vorgelegt.
Auffällig ist der insbesondere in Nordamerika abrupte
Rückgang innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne von
etwa 1.000 Jahren. Dem korrelieren jedoch keine Daten
zu einer vergleichbar dynamischen Entwicklung der
menschlichen Population. Verwiesen wird auf die
Entwicklung neuer Jagdwaffen. Eine andere Hypothese
zur Schließung der Erklärungslücke ist die
Brandjagd-These, wonach die Jäger des Peistocene
Flächenbrände anlegten und damit die
Großsäugerpopulationen über das zur Ernährung
notwendige Maß hinaus dezimierten sowie ihnen
flächenhaft die Lebensgrundlagen entzogen. Paul Martin
sprach gar von einem "Blitzkrieg" des Homo sapiens
gegen die Großsäuger in Nordamerika. Für Australien
gab es nach den Untersuchungen von Trueman und Field
allerdings eine 10.000-jährige Koexistenz von Homo
sapiens und Megafauna ("Proceedings of
the National Academy of Sciences",
07.06.2005).
Für die Umsetzung der Formel von der "Bewahrung der
Schöpfung" ergeben sich aus der Annahme des
Pleistocene overkill dramatische Schlussfolgerungen.
"Was late-Pleistocene extinction so effective in
upsetting the ecosystem that our National Parks,
wilderness areas, and wildlands are an illusion? On a
continent where herbivore herds evolved and thrived
for tens of millions of
years, can there be a natural community without them?"
- Martin in der Einleitung zu Martin/Wright 1967, S.
VI.
Martin erhält in verschroben klingender Weise
neuerdings Unterstützung von Seiten der Geo-Engineers.
So erwägt der Genforscher George Church (Begründer des
Personal Genome Projects), Elefanten durch Mammut-Gene
kältetoleranter zu machen. Sie könnten dann die
auftauenden russischen Permafrostböden verdichten und
uns vor der Freisetzung des darin gebundenen Gases
bewahren. Church gründete im September 2021 das
Startup "Colossal" (sic!) zur Reproduktion des
Wollhaarmammuts.
Lektüreempfehlung: Paul S.
Martin/Herbert E. Wright (Eds.), Pleistocene
Extinctions. The Search for a Cause. New Haven/London:
Yale University Press, 1967
|
|
Jungsteinzeitliche
Ausbeutungsverhältnisse
Die gängige Bezeichnung für den bedeutsamen
kulturellen Umbruch in der Jungsteinzeit zur
Sesshaftigkeit lautet "Revolution". Inzwischen ist al lerdings bekannt, dass der
Übergang von einer Existenz als Sammler und Jäger zur
Seßhaftigkeit mit dem Hauptakzent auf Landwirtschaft und
Viehzucht zumeist nicht so abrupt verlief, wie der
Begriff "Revolution" nahelegt. Landwirtschaft war in
vielen Kulturen kein Gegensatz, sondern lange Zeit
Ergänzung zur Subsistenz als Sammler und Jäger - so etwa
in den Terra-Preta-Kulturen Amazoniens, Afrikas und
Asiens. Und sesshafte Kulturen haben in der Regel
Sammeltätigkeit und Jagd in erheblichem Umfang bewahrt -
zumindest so lange, bis durch Entwaldung und Jagdzüge im
Umfeld der Siedlungen nichts mehr zu jagen und zu
sammeln war. In Europa haben zudem Wildbeuter- und
Ackerbauernkulturen offenkundig über Jahrtausende
unmittelbar nebeneinander existiert. lerdings bekannt, dass der
Übergang von einer Existenz als Sammler und Jäger zur
Seßhaftigkeit mit dem Hauptakzent auf Landwirtschaft und
Viehzucht zumeist nicht so abrupt verlief, wie der
Begriff "Revolution" nahelegt. Landwirtschaft war in
vielen Kulturen kein Gegensatz, sondern lange Zeit
Ergänzung zur Subsistenz als Sammler und Jäger - so etwa
in den Terra-Preta-Kulturen Amazoniens, Afrikas und
Asiens. Und sesshafte Kulturen haben in der Regel
Sammeltätigkeit und Jagd in erheblichem Umfang bewahrt -
zumindest so lange, bis durch Entwaldung und Jagdzüge im
Umfeld der Siedlungen nichts mehr zu jagen und zu
sammeln war. In Europa haben zudem Wildbeuter- und
Ackerbauernkulturen offenkundig über Jahrtausende
unmittelbar nebeneinander existiert.
Zu
einem tatsächlichen Bruch kam es erst durch die
Ausbildung städtisch-feudaler Gesellschaften mit hoher
Arbeitsteilung, die eine erhebliche Effizienzsteigerung
der Nahrungsversorgung erforderte. Bislang wurde davon
ausgegangen, dass erst diese Effizienzsteigerung als
"Revolution" die Ausbildung von städtischen Strukturen
ermöglichte und deren weitere Ausgestaltung stärkte, um
etwa komplexe Bewässerungssysteme aufzubauen und zu
erhalten. James Scott hat in seiner Studie "Against the
Grain" die entgegengesetzte Position entwickelt. Scott
zufolge wurde der Übergang zur ortsgebundenen
Landwirtschaft wesentlich erzwungen, und zwar durch die
Oberschichten städtischer Konglomerate. Am Beispiel der
Stadt Uruk vor 5.200 Jahren kann er plausibel machen,
dass der Bedarf dieser anspruchsvollen städtischen
Gesellschaft durch erheblichen Druck nach innen und die
nötigende Ansiedlung umliegender Volksgruppen für die
landwirtschaftliche Produktion (eine frühe Form der
"Schollenbindung") gedeckt wurde. Und dabei spielte
Getreide eine vorrangige Rolle, wie bei allen frühen
Stadtstaaten. Scott erklärt dies damit, dass
Getreideanbau und insbesondere die Getreideernte besser
kontrolliert werden konnten und Getreide akkumulierbar
war, da weniger verrottungsanfällig als andere
Ackerfrüchte. Getreide trage so wesentliche Merkmale des
Geldes und sei optimal zu besteuern. Die Entwicklung der
Landwirtschaft war in Uruk und anderen frühen
Stadtstaaten eng verbunden mit Sklaverei,
ausbeuterischer Arbeit, hoher Sterblichkeit. Die oft
besungene "fruchtbare Wiege" der Zivilisation war nach
Scott für die meisten Bewohner ein von Seuchen
heimgesuchtes Jammertal endloser Arbeit auf den Feldern,
mit massiver Umweltzerstörung durch Rodungen und
großflächiger Bodenversalzung durch die Bewässerung.
Nun ist allerdings Uruk ein Sonderfall, der nicht
schlicht übertragen werden kann etwa auf die
jungsteinzeitliche Sesshaftwerdung in Mittel- und
Westeuropa. Und auch für die unmittelbare Nachbarschaft
Uruks ist daran zu erinnern, dass schon mehr als
sechstausend Jahre zuvor am Göbekli Tepe die
Sesshaftigkeit einsetzte und zu komplexen Kooperationen
führte - so zu einem Tempelbau, der bislang als erster
Tempelbau der Menschheit gilt. Über
Ausbeutungsverhältnisse am Göbekli Tepe wird (noch)
nicht spekuliert, stattdessen über "Urkommunismus am
Göbekli Tepe" (Lars Hennings).
Scott stellt seiner Arbeit programmatisch ein Zitat von
Claude Lévi-Strauss voran, der schrieb: "Writing is a
strange thing. (...) it seems to favor rather the
exploitation than the enlightenment of mankind." ("A
Writing Lession", 1961) Was Scott dann grundsätzlich zum
Verhältnis von Getreide und Geld sowie Getreide und
Herrschaft ausführt, ist für das Verständnis
menschlicher Naturverhältnisse von erheblicher
Bedeutung. Seine Untersuchung "Against the Grain"
schärft unseren Blick für den Zusammenhang von
Naturbeherrschung und Herrschaft von Menschen über
Menschen. Und es schärft den Blick darauf, wie
weitreichend die Entscheidung für den Anbau bestimmter
Nahrungsmittel die Entwicklung von Gesellschaften und
Kulturen ebenso prägt wie die Formierung der Umwelt. Die
jungsteinzeitliche "Revolution" bedeutete nicht nur die
Durchsetzung der Sesshaftigkeit, sondern auch die erste
Schichtung der Gesellschaft nach Besitzverhältnissen
sowie die erstmals über abhängige Arbeitskraft
vermittelten Eingriffe in den Naturhaushalt. Sie prägte
das Naturverhältnis europäischer Gesellschaften bis
hinein ins ausgehende Mittelalter (s. Abb. rechts).
Abbildung: Stundenbuch des Duc de
Berry - Juli, 15. Jahrhundert
Lektüreempfehlung: James C. Scott, Against the Grain. A
Deep History of the Earliest States. Yale University
Press, 2017
|
|
Daniel Quinn: Ismael
Daniel Quinn (*1935) besuchte als Schüler
eine private Jesuitenschule, studierte in St.
Louis/Missouri und Chicago Anglistik und verbrachte 1955
ein Auslandssemsester in Wien. Nach dem Abschluss seines
Studiums bereitete er sich an der Abtei "Our Lady of
Gethsemane" in Kentucky auf ein Leben als
Trappistenmönch vor, brach allerdings auf Empfehlung
seines Mentors Thomas Merton (Autor von "The Way of
Chuang Tzu" u.a.) ab, trat später gar aus der
katholischen Kirche aus, und wurde, was er schon früh
erstrebt hatte, Schriftsteller. In den 70er Jahren
gründete er eine Schreibgruppe am Stateville-Gefängnis
in Illinois.
Sein bekanntestes Buch ist "Ismael", beendet 1991,
erstmals erschienen 1992, als dessen Held ein Gorilla
figuriert, der über Telepathie mit Menschen zu
kommunizieren vermag und der bestrebt ist, die Welt vor
dem industriell-zivilisatorisch angebahnten Untergang zu
bewahren, indem er Schülern sein subversives Weltwissen
weitergibt. In "Ismael" ist sein Schüler ein weißer
Amerikaner mittleren Alters, dessen Name im Buch nicht
genannt wird. Quinn bearbeitete sein Thema nochmals in
"Ismaels Geheimnis", 1997 erschienen, nun aus der
Perspektive einer zwölfjährigen Schülerin, Julie
Gerchak.
Ismaels Botschaft ist die vom Sündenfall der
Zivilisation, der durch Einsicht zu korrigieren sei. Mit
dem biblischen "Im Schweiße deines Angesichts ...", dem
Benediktiner und ihre Abkömmlinge, die strengeren
Zisterzienser und deren wiederum strengeren Abkömmlinge,
die Trappisten, in besonderer Weise verpflichtet sind,
sei dieser Sündenfall religiös perpetuiert worden.
Ausdrücklich wird im Roman auch auf das biblische "Macht
euch die Erde untertan" hingewiesen. Es sei Teil des
zivilisatorischen "Mythos der Nehmer" (Quinn 1992, S.
159).
Die "Nehmer/Taker" sind im Weltbild Ismaels die
Vertreter eines linearen Fortschrittsdenkens, Träger von
Kulturen mit dem Anspruch, genau zu wissen, was "wahr"
und "falsch" sei. Sie seien etwa 8000 vor Christus
erstmals aufgetreten und haben, so Ismael/Quinn, seitdem
die Welt erobert (Quinn 1992, S. 144). Vor ihnen
bestimmten die "Lasser/Leaver" die menschliche Präsenz
auf dem Planeten Erde, sie wurden jedoch zunehmend von
den Nehmern verdrängt und als "primitiv"
diffamiert. Der Unterschied Nehmer-Lasser ist bei Quinn
allerdings nicht identisch mit dem zwischen
Jäger/Sammler und Ackerbauern. Auch Ackerbauern können
"Lasser" sein (Quinn 1992, S. 113). Allerdings lässt
Ismael das Aufkommen der "Nehmer" beginnen mit der
"landwirtschaftlichen Revolution" (Quinn 1992, S. 144,
Parallelstellen z.B. S. 44 und S. 68). Der amerikanische
Biologe Raymond Dasmann unterscheidet in "Toward a
Biosphere Consciousness" 1988 zwischen
"Ökosystem-Menschen" und "Biosphären-Menschen". Wobei
"Ökosystem"-Denken negativ ausbeuterisch belegt ist.
Dasmanns Unterscheidung entspricht weitgehend der von
Quinn in "Nehmer" und "Lasser".
In seiner Danksagung zu "Ismaels Geheimnis" verweist
Quinn auch auf Richard Dawkins Theorie zum "Egoistischen
Gen" (1976) als Inspirationsquelle.
Lektüreempfehlung: Daniel Quinn, Ismael. Goldmann 1992
|
|
Der Tod Humbabas
Im Gilgamesch-Epos aus dem 2. Jahrtausend vor
Christus erscheint als zentrale Heldentat des Gilgamesch
die Tötung Humbabas/Huwawas. Humbaba ist ein vom Gott
Enlil eingesetzter Wächter über einen Zedernwald
westlich von Mesopotamien an den Hängen des
Libanon-Gebirges (genannt wird auch das
Sirara-/Kalamun-Gebirge). Gilgamesch wird unterstützt
von seinem Freund Enkidu, den Humbaba
allerdings als Vertrauten sieht und mehrfach um
Schonung bittet, da auch Enkidu aus der Wildnis, den
"Bergen" gekommen sei. Es war eine Göttin (Ištar) in
Person einer Priesterin (Šamḫat), die Enkidu in Uruk
zunächst in die Kultur der Sexualität einführte, dann
weiter zivilisierte und Gilgamesch als Freund
zuführte. Doch Enkidu verleugnet seine Herkunft und
ermutigt Gilgamesch, Humbaba zu töten. Als Enkidu zur
Strafe dann von den Göttern mit einer tötlichen
Krankheit geschlagen wird, beklagt er auf der siebten
Tafel des Gilgamesch-Epos, seine heimatliche Wildnis
in den Bergen je verlassen zu haben.
Ziel der Heldentat war, ganz und gar unmythologisch, die
Zedern zu fällen, um den Status und den Wohlstand
Uruks zu mehren. Es ist
heute schwer vorstellbar, wie die Zedern unter den
Bedingungen der Zeit über eine Strecke, die in Luftlinie
etwa 1.000 Kilometer umfasst, dann nach Uruk
transportiert werden sollten. Im Epos selbst ist ein
heute nicht mehr gangbarer Weg beschrieben, auf dem
Wasser. So heißt es auf der fünften Tafel über eine
bestimmte Zeder, "deren Wipfel an die Himmel stieß",
"nach Nippur möge sie der Euphrat tragen" - zum Tempel
Enlils, dessen Wächter die beiden Helden gerade
erschlagen haben. Und ganz offensichtlich befinden sich
die beiden an einem Fluß, der damals noch (oder auch nur
in der Legende) dem Euphrat zufloss. Denn sie binden ein
Floß, das sie zurück nach Uruk trägt.
Dass die Großtat des Gilgamesch die
Verkarstung der Region einleitete und langfristig auch
zum Niedergang der Kulturen Mesopotamiens beitrug,
scheint den Autoren des Gilgamesch-Epos durchaus
bewußt. Denn diese Tat führt letztlich - zusammen mit
der Tötung des Himmelsstiers als zweiter Heldentat des
Gilgamesch - dazu, dass Enkidu sterben muss und
Gilgamesch selbst aus Angst vor dem eigenen Tod die
Stadt verlässt und in die Wildnis zieht. Und in einem
erst 2011 bekannt gewordenen Fragment der fünften
Tafel erscheint Humbaba in einem durchaus positiven
Bild, nicht einfach als grober Bösewicht, als der er
bislang in den Übersetzungen gezeichnet wurde. Enkidu
klagt in diesem Fragment "wir machten den Wald zur
Einöde". Doch erst unter Nebukadnezar II. sollten die
Wälder des Libanon tatsächlich weitgehend kahl
geschlagen werden.
Das Gilgamesch-Epos kulminiert auf der elften Tafel im
Sintflut-Bericht des Utnapischtim, dessen
entscheidende Botschaft an Gilgamesch ist, dass er
nicht durch seine beiden "Heldentaten", sondern durch
Einsatz für die Anliegen seines Volkes, auch der
einfachen Menschen, der Armen (wir dürfen ergänzen:
die keine Tempel und Paläste aus Zedernholz brauchen),
zu seiner Bestimmung finde. Der Sintflut-Bericht kann
also durchaus gelesen werden als gezielte Mahnung zum
"Politikwechsel" an Gilgamesch und an den von ihm
zunächst vertretenen "alten" Menschentypus der
Heldenzeit, der die Götter herausforderte und damit
Naturkatastrophen heraufbeschwörte wie das Versiegen
der Flüsse (im Kontext der Tötung des Himmelsstieres)
oder eben die Sintflut.
Nach der Landung der Arche listet der Gott Ea
gegenüber dem Gott Enlil auf, was anstelle der
Sintflut besser hätte getan werden können, um der
Naturzerstörung und damit Selbstzerstörung der
Kulturen des Zweistromlandes Einhalt zu gebieten:
"Statt daß du die Sintflut sandtest, hätte der Löwe
sich erheben sollen, um die Menschenmenge klein zu
halten!" Und weiters werden als Mittel zur Eindämmung
des Siedlungsdrucks noch aufgeführt "der Wolf",
"Hungersnot" und "Erra" (eine Gottheit, die Seuchen
bringt).
Abbildung:
Gilgamesch und Enkidu erschlagen Humbaba, 19.-17.
Jahrhundert vor Christus
Textgrundlage: Stefan Maul, Das Gilgamesch-Epos. Neu
übersetzt und kommentiert, Beck, 2005
|
|
Sintflut
Die drei bekanntesten Sintflut-Berichte, aus
Indien, Babylon und der Levante, sind sich darin einig,
dass der auserwählte Mensch - Vaivasvata Manu, Utnapischtim
(Uta-napischti), Noah - ein Schiff bauen
solle, um für die belebten Wesen das Überleben zu
sichern. Im Śatapatha-Brāhmaṇa
bleibt Vaivasvata nach der Flut zunächst alleine, doch
aus seinen Opfergaben (u.a. Butterschmalz) entsteht im
Verlauf eines Jahres eine weibliche Partnerin für ihn,
mit der gemeinsam er Nachkommen hat. Im 3. Buch des
Mahabharata nimmt Vaivasvata auf sein Schiff "all die
verschiedenen Samen mit, welche einst die
zweifachgeborenen Brahmanen aufgezählt haben". Dieser
Bericht endet mit "Vaivasvata war willens, die Welt neu
zu erschaffen". Ähnliche Berichte gibt es in den Puranas
(Matsya-Purana und Bhagavata-Purana). Im
babylonischen Gilgamesch-Epos nimmt Utnapischtim
"allerlei Lebenssamen" mit auf sein Schiff, seine
ganze Familie sowie "Vieh des Feldes,
Getier des Feldes und alle Werkleute". Am
elaboriertesten erscheint die biblische Noah-Erzählung,
vermutlich auch die jüngste der drei Legenden, in
welcher vier Menschenpaare, sieben Paare von
"reinen" Tieren und je ein Paar "unreiner" Tiere auf die
Arche gehen.
Wir haben uns daran gewöhnt, die Sintflut-Berichte als
Erzählungen von (menschlicher) Schuld und (göttlicher)
Strafe zu lesen, dramatisch aufgeladen durch einen
(göttlichen) Gnadenakt für eine herausragende
Einzelperson, die sich durch besondere Frömmigkeit
auszeichnete. Gelesen als Dokumente menschlicher
Naturverfügung gewinnen sie eine neue Dimension. Sie
werden deutbar als Zeugnisse einer Auffassung, die es
Menschen zutraut, eine gewaltige Naturkatastrophe zu
überstehen und danach einen ausschließlich kulturell
begründeten Neuanfang zu starten, der Züge einer zweiten
- nun menschlichen - Schöpfung trägt. Im
Mahabharata-Epos wird dieses Moment einer zweiten
Schöpfung auch explizit formuliert: "Und Vaivasvata war
willens, die Welt neu zu erschaffen." Damit wird der
Mythos zum kaum überbietbaren Ausdruck menschlichen
Selbstbewußtseins im Naturumgang - lange vor
stalinistischem Terraforming und ähnlichen
technologischen Großprojekten.
Entsprechungen zu diesen drei Sintflutberichten gibt es
in zahlreichen weiteren Kulturen. Bei Hesiod und anderen
griechischen Autoren finden wir die "Deukalionische
Flut". Deukalion war Sohn des Prometheus, des
Menschenfreundes, und dieser befahl ihm, ein Schiff zu
bauen, um so mit seiner Frau Pyrrha der Flut zu
entkommen. Von Tieren ist hier nicht die Rede, nur die
Rettung der Menschen wird thematisiert. Eine
Inka-Legende berichtet von einem Lamahirten, den das
Verhalten seiner Tiere vor einer Flut warnte. Er stieg
mit seiner Familie auf einen hohen Berg und blieb so
verschont. Bei den Guarani-Indianern an der Ostküste
Südamerikas gibt es die Legende von Tamandere, der mit
seiner Frau auf einer schwimmenden Palme gerettet wurde,
während alle Berge im Wasser versanken, auf denen seine
Gefährten Schutz gesucht hatten. Die Azteken und andere
mittelamerikanische Indianer kennen Sintflutlegenden, in
denen ein großes Floß gezimmert wurde, dessen Benutzer
durch einen Kolibri mit einem grünen Blatt im Schnabel
erfuhren, in welcher Richtung sie wieder trockenes Land
finden konnten. Auch bei den nordamerikanischen
Indianern gibt es Flutberichte - allerdings fällt dort
kein anhaltender Dauerregen, sondern Flutwellen
überschwemmen das Land. Fast allen Legenden gemeinsam
ist der starke Akzent auf den Neuanfang danach.
Diese Berichte können gelesen werden als Nachklänge
einer globalen Katastrophe - möglicherweise mehrerer
unterschiedlicher, regional differenzierter
Katastrophen. Die teilweise verblüffenden
Motiventsprechungen über Kontinente hinweg lassen sich
deuten als Hinweise auf einen Kulturaustausch in
frühgeschichtlichen Zeiten, der weit über das uns
bislang Bekannte hinausging - es könnte sich aber auch
schlicht um Übertragungen bei der Sammlung der nord-,
süd- und mittelamerikanischen Legenden im 20.
Jahrhundert durch den Atlantologen Charles Berlitz
(1914-2003) und andere handeln.
|
|
Atharvaveda XII,1
- Hymnus an die Erde
"Die große Hymne an die Erde" wird XII,1 (Kanda
XII, Sukta 1, Mantras 1-63) der
Atharvaveda in den deutschen
Übersetzungen genannt. Im Text gibt es Hinweise auf den
Bergbau (Mantra 35), er dürfte daher in der frühen
indischen Eisenzeit entstanden sein, am Ende des 2.
Jahrtausends vor Christus. Die Atharvaveda gehört nicht
zu den kanonisierten Schriften des Hinduismus. Und
insbesondere im Hymnus an die Erde begegnet uns eine
Weltanschauung, die wenig zu tun hat mit dem, was wir
aus den Brahmanas und den Upanishaden kennen. Fremd
mutet dieser Text innerhalb der heiligen Literatur des
Hinduismus an, erinnernd an den Aton-Hymnus Echnatons.
Die Überlieferung besagt, dass an der Abfassung der
Texte des Atharvaveda auch Frauen beteiligt waren,
während die einige Jahrhunderte jüngeren Texte der
Brahmanas und der Upanishaden wohl ausschließlich von
Männern geschrieben wurden, Angehörigen der beiden
obersten Kasten, der Brahmanen und der Kshatriyas.
Unzweifelhaft dokumentiert dieser Text noch matriarchale
Traditionen.
Im Hymnus an die Erde geht es nicht um die Überwindung
von Leid und Begehren, um Weisheit und Abkehr von den
niederen Sinnen, wie uns dies aus den Upanishaden
vertraut ist, sondern um ein gelingendes praktisches
Leben. Die im Hymnus angesprochene "Erde" ("pṛthivī" -
die Weite, das weite Land) ist weder eindeutig Schöpfung
(natura naturata) noch eindeutig Schöpfungsprinzip
(natura naturans). Angesprochen wird vielmehr in einer
ganz und gar pragmatisch anmutenden Weise die Erde, der
Planet mit seiner konkreten Gestalt und Materialität
selbst - versehen mit Attributen eines nährenden,
produktiven Prinzips. So wird die Erde im Mantra 17
explizit als "Mutter der Pflanzen" vorgestellt, an
anderer Stelle (Mantra 10) als die Menschen nährende
"Mutter Erde" ("pṛthivī mātā").
Eines ihrer wichtigsten Attribute ist der Wald (11, 27).
Daneben werden die wärmende Sonne (Mantra
15) und Prajāpati, der androgyne Schöpfergott der Veden
(Mantra 43) genannt. Allerdings bleibt dessen
Funktion untergeordnet, denn es ist die Erde, "die
alles im Schoße trägt". Die männliche
Ergänzung der Erde, ihr Gatte Parjanya, zuständig für
den Regen, wird gleichfalls nur nebenbei gewürdigt
(Mantras 12 und 42). Erwähnt wird auch Agni, in den wohl
nachträglich eingefügten Mantras 19 und 20. Die
Götternamen erscheinen eher pflichtgemäß eingestreut,
Opfer und Zauber spielen eine untergeordnete Rolle in
diesem Text - anders als in sonstigen Texten der
Atharvaveda.
Die Anrufung der Erde in diesem Hymnus bleibt nahe an
den konkreten Erscheinungen. Besonders bemerkenswert ist
dabei Mantra 35, das klingt wie eine Selbstverpflichtung
zu nachhaltigem Naturumgang: "Was ich von dir, o Erde,
ausgrabe, das soll schnell zuheilen. Laß mich, o
Reinigende, nicht deine empfindliche Stelle, nicht dein
Herz durchbohren!" Hier wird offensichtlich der Bergbau
angesprochen, was auch die Datierung auf den Beginn der
indischen Eisenzeit nahelegt. Kein rituelles Opfer zum
Ausgleich der Eingriffe wird angeboten, der Text
verweist vielmehr auf die Selbstheilungskräfte der Natur
- verbunden mit dem Versprechen rücksichtsvollen
Umgangs.
In diesem Kontext möchte ich auch an eine Weissagung
der Hopi-Indianer erinnern, die von Godfrey Reggio
1982 in seinem Film "Koyaanisqatsi" zitiert wird:
„Wenn wir wertvolle Dinge aus dem Boden graben, laden
wir das Unglück ein.
Wenn der Tag der Reinigung nah ist, werden Spinnweben
hin und her über den Himmel gezogen.
Ein Behälter voller Asche wird vom Himmel fallen, der
das Land verbrennt und die Ozeane verkocht.“
Textgrundlage:Klaus
Mylius (Hrsg.), Älteste indische Dichtung und Prosa,
Wiesbaden: VMA-Verlag, 1981
|
|
Prometheus-Mythos
Der Prometheus-Mythos ist uns umfangreich
überliefert einmal in der Theogonie des Hesiod (ca. 740
bis 670 v. Chr.), verfasst in der ersten Hälfte des 7.
vorchristlichen Jahrhunderts, einmal in einer Tragödie
des Aischylos (wobei diese Zuschreibung von einigen
Wissenschaftlern angezweifelt wird, der Zeus-Darstellung
wegen), "Der gefesselte Prometheus", vermutlich um das
Jahr 472 v. Chr. entstanden.
Bei
Hesiod in der "Theogonie" begegnet uns Prometheus
als listiger Gott, der den Göttervater Zeus gelegentlich
im Interesse der Menschen an der
Nase herumführt und von diesem dafür bestraft wird. Zwei
Stellen gibt es zu dieser Strafe bei Hesiod, die nicht
eindeutig in Einklang zu bringen sind, zunächst wird in
den Versen 521-534 Prometheus an einen Felsen gekettet,
ein Ad ler frisst die immer wieder
nachwachsende Leber des Gefesselten. In den Versen
613-616 könnte als Fessel ("desmos") aber auch das
"Geschlecht und Volk der Weiber" ("genos kai phyla
gynaikon") verstanden werden, das in den
Versen davor (591-612) in reichlich
burlesk-komödiantischer Weise als Fessel der Menschheit
(=Mannheit) geschildert wird. Wollte Hesiod hier - zur
Unterhaltung des (männlichen) Publikums seiner Rhapsodie
- signalisieren, dass Verheiratetsein so schlimm sein
könne wie das Schicksal des Prometheus? ler frisst die immer wieder
nachwachsende Leber des Gefesselten. In den Versen
613-616 könnte als Fessel ("desmos") aber auch das
"Geschlecht und Volk der Weiber" ("genos kai phyla
gynaikon") verstanden werden, das in den
Versen davor (591-612) in reichlich
burlesk-komödiantischer Weise als Fessel der Menschheit
(=Mannheit) geschildert wird. Wollte Hesiod hier - zur
Unterhaltung des (männlichen) Publikums seiner Rhapsodie
- signalisieren, dass Verheiratetsein so schlimm sein
könne wie das Schicksal des Prometheus?
In Hesiods "Werke und Tage", wird der Mythos sachlicher
und knapper vorgestellt - wobei der zeitliche Bezug zur
"Theogonie" umstritten ist. Hier ist es nicht das
Geschlecht der Frauen allgemein, das der Menschheit
Unheil bringt, sondern lediglich Pandora, die über den
Bruder des Prometheus, Epimetheus, zu den Menschen
gelangt. Allerdings bleiben die Ausführungen mehrdeutig,
zumal das Altgriechische für "Mann" und "Mensch" das
gleiche Wort "anthropos" verwendet. Die Fesselung des
Prometheus an den Felsen wird in "Werke und Tage" nicht
erwähnt, Zeus wendet sich an Prometheus lediglich in den
Versen 53-56 mit der Drohung, er werde sich "dir selber
und den kommenden Menschen zum Unheil" rächen für den
Feuerraub - und zwar, wie dann in den nachfolgenden
Versen ausgeführt wird, durch die Schaffung der Pandora.
Diese Zuspitzung könnte der Abfassung des Textes als Mahnung
für Hesiods Bruder Perses geschuldet sein, dem Hesiod
Habgier vorwarf - aber darüber hinaus als Mahnung für
die zeitgenössische Gesellschaft insgesamt.
Aischylos stützt sich auf Hesiod, aber vermutlich auch
auf andere, uns unbekannte Quellen. Prometheus erscheint
bei Aischylos ganz explizit als Menschenfreund, als
Kulturbringer, gar als Erlöserfigur, die gegen den
strafenden Zeus die Interessen der Menschheit
verteidigt.
Im 20. Jahrhundert wurde Prometheus aus
technikkritischer Position zum Symbol einer
selbstzerstörerischen Technokratie, die insbesondere
durch die Anhäufung der Atomwaffenarsenale, aber auch
durch rücksichtslose Ressourcenausbeutung und
Umweltverschmutzung das Leben nicht nur der Menschen auf
dem Planeten ernsthaft bedroht. In der amerikanischen
Forschung zum Naturverhältnis der Sowjetunion (Stephen
Brain, Douglas Weiner) werden als "Promethians" die
Vertreter einer Position bezeichnet, die Natur als
beliebige Verfügungsmasse des menschlichen Zugriffs
verstehen und eine vollständig technologisch verfügte
und gestaltete Umwelt als Ideal anstreben. Klaus
Heinrich hat dem eine Rehabilitation der
Prometheus-Figur als kritischer Aufklärer im
politisch-sozialen Verständnis gegen alle Formen von
Herrschaft - auch die einer totalitären Herrschaft über
die natürliche Umwelt - entgegen gehalten.
Abbildung: Griechische Schale 550 v.Chr.
Lektüreempfehlung: Klaus Heinrich,
Dahlemer Vorlesungen 8. Gesellschaftlich vermitteltes
Naturverhältnis. Begriff der Aufklärung in den
Religionen und der Religionswissenschaft, Frankfurt
(Main)/Basel: Stroemfeld, 2007
|
|
"Bewahrung der
Schöpfung" oder "Macht euch die Erde untertan"?
Das Christentum wurde von der
Ökologiebewegung lange als ideologisch mitverantwortlich
für den menschlichen Raubbau an der Natur angesehen. Die
biblische Forderung "füllet die Erde und machet sie
euch untertan" (1. Mose 1,28 - Lutherbibel 1984), das
"Dominium terrae", sei die Grundlegung für eine
jahrhundertelange Ausbeutung der Naturressourcen im
menschlichen Interesse. Ausgearbeitet wurde
diese Position vor allem durch den Technikphilosophen
Lynn Townsend White, der 1966 in seinem Aufsatz "The
historical roots of our ecological crisis" die
jüdisch-christliche Begründung der
Naturbeherrschung als Motor der Industrialisierung und
Naturausbeutung vorstellte. Kritisch setzte sich mit
seinen Thesen der Theologe Udo Krolzik auseinander in
"Umweltkrise - Folge des Christentums?", 1979.
Nach seiner Überzeugung schuf erst die
Säkularisierung die Voraussetzungen für eine
umweltzerstörende Naturbeherrschung (Krolzik 1979, S.
84).
1983 einigte sich auf Anregung der DDR-Delegation und
des Ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel - im
Gedenken des Atombombenabwurfs auf Hiroshima, mit Blick
auf das anhaltende Wettrüsten und die Umweltkrise - die
Vollversammlung des (christlichen) Weltkirchenrates in
Vancouver auf einen "konziliaren Prozess
gegenseitiger Verpflichtung auf Gerechtigkeit, Frieden
und Bewahrung der Schöpfung/Conciliar Process of mutual
commitment to justice, peace and the integrity of
creation". Dieser Ansatz kann sich gleichfalls auf
Bibelstellen berufen, so insbesondere auf 1. Mose 1,31
("Und Gott sah, dass es gut war.") und 1. Mose 2,15
("Und Gott der HERR nahm den Menschen und setzte ihn in
den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte.")
Die relevanten Bibelstellen stammen allerdings aus dem
Alten Testament. Im Neuen Testament finden sich keine
vergleichbaren Passagen. Der Begründer des Christentums
und seine frühen Anhänger haben sich ganz offenkundig
für den Umgang mit den weltlich-natürlichen Ressourcen,
mit der konkreten Schöpfung wenig interessiert - anders
als etwa 600 Jahre später Mohammed und seine Anhänger.
Dies kann allerdings auch vor dem Hintergrund verstanden
werden, dass die Tora für Christus und das frühe
Christentum weiterhin (mit den Modifikationen und
Ergänzungen des "ich aber sage euch") in Gültigkeit
blieb und als Teil des Alten Testamentes bis heute im
Christentum Bestand hat. Die neue Botschaft des
Christentums bezog sich auf das Verhältnis der Menschen
untereinander und zu Gott, nicht auf ihr
Schöpfungsverhältnis. Natur erscheint im Neuen Testament
als genutzte Natur, als Weinberg, Olivenhain, Schaf-
oder Schweineherde - und dies nur randständig.
Für die umstrittene Stelle 1. Mose 1,28 wird in jüngerer
Zeit gefragt, ob die gängigen Übersetzungen dem
Gemeinten gerecht werden, ob nicht eher ein gleichsam
gärtnerischer Umgang (wie ihn 1. Mose 2,15 nahelegt)
intendiert gewesen sei. Doch sind die Originalquellen in
ihren Aussagen eindeutig. Das hebräische " rə·ḏū" bedeutet "regiert", "ḵiḇ·šu·hā" bedeutet "unterwerft/nehmt
in Besitz". Und so haben das auch die Verfasser
der Septuaginta verstanden. Dort steht: "καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς καὶ ἄρχετε" -
"und unterwerft sie (die Erde/" τὴν γῆν") und
regiert (die Fische ...)". Der Theologe und
Kabarettist Matthias Schlicht hat 1999 in einem
Vortrag zur Gentechnik angeführt, dass "radah" im
fruchtbaren Halbmond auch das Verhältnis eines
Hirten zur Ziegenherde benennen konnte und "kabasch"
biblisch auch die Urbarmachung von Land bezeichne
(Josua 18). Nun geht es in Josua 18,1 allerdings um
Landteilung nach einer Eroberung/Unterwerfung - und
Urbarmachung wird in Josua 17,18 als Waldrodung
angesprochen, mit einem Wort, das eher Kahlschlag
meint als gärtnerische Pflege. Auch wenn dem
Kahlschlag Anbau folgt, bleibt ein Unbehagen bei den
aktuellen Deutungsversuchen zu 1. Mose 1,28 als
Ausdruck eines ökologisch achtsamen
Naturverhältnisses.
Die Auffassung, das Christentum habe die Menschheit
der Natur gegenüber achtsamer gemacht im Vergleich
zur Antike, findet sich explizit schon Anfang des
19. Jahrhunderts bei Alexander von Humboldt. In
seinem "Kosmos" (1845-1862) schreibt er im V.
Kapitel, "Naturbeschreibung. Naturgefühl nach
Verschiedenheit der Zeiten und der Volksstämme":
"Die christliche Richtung des Gemüts war die, aus
der Weltordnung und aus der Schönheit der Natur die
Größe und die Güte des Schöpfers zu beweisen." Er
nennt als ersten Beleg Naturschilderungen in der
Schrift "Octavius" des christlichen Apologeten
Marcus Minucius Felix aus der Zeit um 200 nach
Christus und zitiert ausführlich dann aus Schriften
des Kirchenlehrers Basilius von Caesarea (330-379).
Es ist festzuhalten, dass das 1. Buch Mose für beide
Positionen Unterstützung bietet, für die moderne
"Bewahrung der Schöpfung" ebenso wie für ein
radikales "Macht euch die Erde untertan", wie es von
Bacon und Descartes an bis ins 20. Jahrhundert
hinein gelesen wurde. Allerdings ist für beide
Positionen keine spezifisch "christliche" Herleitung
aus den kanonisierten Schriften des Christentums
möglich. Einen Schlüsseltext zum Verständnis des
Kulturprozesses, der die beiden Positionen
strukturierte, bietet "Iudicium Iovis" von Paulus
Niavis, 1495. Der Text wird weiter unten
vorgestellt.
Festzuhalten
ist auch, dass die unmittelbare Gottesbezogenheit
des einzelnen - menschlichen - Individuums als
fundamentaltheologische Position mit der
Schöpfungsverantwortung aktuell in erhebliche
Interessenkonflikte gerät. In extremis bedeutet
diese ja, das Überleben auch nur eines einzigen
Menschen über das Überleben der gesamten Pflanzen-
und Tierwelt zu stellen. Bestenfalls eingeschränkt
durch deren Notwendigkeit für das Überleben dieses
einen Menschen.
Als
rechtsphilosophische Position hat Georg
Wilhelm Friedrich Hegel in seinen
"Grundlinien der Philosophie des Rechts", §
44, die Herrschaftsposition auf beklemmende
Weise festgeklopft: "Die Person hat das
Recht, in jede Sache ihren Willen zu legen,
welche dadurch die meinige ist, zu ihrem
substantiellen Zwecke, da sie einen solchen
(Zweck - H.Sch.) nicht in sich selbst hat,
(zu - H.Sch.) ihrer Bestimmung und Seele
meinen Willen erhält, - absolutes
Zeignungsrecht des Menschen auf alle
Sachen." Ausdrücklich sind hier nach einer
Notiz Hegels auch die Tiere als Sachen
mitgemeint. Alle Gegenpositionen werden nach
Hegel widerlegt "von dem Verhalten des
freien Willens gegen diese Dinge". Wobei,
christlich gesprochen, der freie Wille es
uns eben auch erlaubt, das "Böse" zu wählen.
Lektüreempfehlung:
Udo
Krolzik, Umweltkrise - Folge des Christentums?
Stuttgart/Berlin 1979
|
|
Die Hängenden Gärten
von Babylon
In der Regierungszeit des
babylonischen Königs Nebukadnezar II. (geboren ca. 640,
Regierungszeit 605 bis 562 v. Chr., zuvor schon ab 620
von seinem Vater eingebunden in die Regierungsgeschäfte)
wurden das Ischtar-Tor errichtet, die Medische Mauer
gebaut, der Turmbau zu Babel vollendet und die Hängenden
Gärten angelegt. Nebukadnezar II. betrieb auch eine
forciert aggressive Außenpolitik, so wurde 587 v.
Chr. von seinen Truppen der Tempel von Jerusalem
zerstört.
Die Hängenden Gärten als eines der sieben Weltwunder der
Antike werden üblicherweise mit dem Namen der Semiramis
verbunden, einer Königin, die etwa 200 Jahre vor
Nebukadnezar in Babylon regierte. Nach den Ausgrabungen
und Untersuchungen Robert Koldeweys handelte es sich
allerdings eindeutig um ein Bauwerk Nebukadnezars,
errichtet für seine Frau Amyitis, die aus dem Land der
Meder stammte, einer grünen und bergigen Region südlich
des Kaspischen Meeres. "Hängend" ist dabei keine
stimmige Bezeichnung, basierend auf dem griechischen
"kremastoi", das auch "schwebend" bedeuten kann. Es
handelte sich offensichtlich um begrünte
Gebäudeterrassen, ein erstes Vorbild also für das, was
Harry Glück in Wien, Alt-Erlaa, 1973-1985 bauen ließ und
was heute Architekten wie Rüdiger Lainer weiter
verfolgen. Die Bewässerung der Terrassenanlage wurde
durch einen Paternoster bewerkstelligt, dessen Reste
Koldewey entdeckte.
Wer die Hängenden Gärten in ihrer Bedeutung für die
Kulturgeschichte der Naturverfügung verstehen möchte,
darf den Bezug zu den anderen Bauwerken Nebukadnezars
nicht unterschlagen. Auf Nachhaltigkeit waren die
Hängenden Gärten so wenig angelegt wie Turm und Mauer -
es ging um die Bedürfnisse einer kleinen Elite, um
Herrschaft und ihren Erhalt. Um Babylon zu entwickeln
wurden unter anderem die Zedernwälder des Libanon
weitgehend abgeholzt. Die Hängenden Gärten sollten uns
daher aufmerksam machen für die Ambivalenzen auch grüner
Utopien - sichtbar geworden zuletzt in den fatalen
Konsequenzen der Förderung von Biosprit. Schlecht
eingesetzt zerstört auch ein ökologisch fundierter
Ansatz die Landschaft und soziale Systeme, klug
eingesetzt kann selbst der Bagger auf der Almwiese
Landschaft und Biodiversität steigern, wie das
Permakulturkonzept des Sepp Holzer zeigt, das
Geoengineering im Kleinen einsetzt unter der Prämisse,
die Natur anschließend weitgehend alleine machen zu
lassen. Was Holzer praktiziert hat Vorläufer etwa in den
Klosteranlagen der Zisterzienser mit ihren
Karpfenteichen.
Festzuhalten bleibt: Auch grüne Utopien haben einen
substantiellen Bezug zu dem, was die Kulturgeschichte am
Beispiel des Turmbaus zu Babel aus alttestamentarischer
Sicht als "Hybris" brandmarkt, der (göttliche) Strafe
auf den Fuß folge ("Hochmut kommt vor dem Fall"). Die
Hängenden Gärten verbildlichen ein positives Potenzial
menschlicher Eingriffe in den Naturhaushalt, heute
verengt als "Ausgleichsmaßnahmen" gehandelt. Der Turmbau
zu Babel sollte uns aber zugleich an die notwendige
Bilanzierung kultureller, sozialer, politischer und
ökologischer Kosten aller, auch ausgleichender,
Eingriffe erinnern.
|
|
Dào Kě Dào Fei
Cháng Dào
Wenig wissen wir über Laozi (Laotse, Lao-tse,
Lao Tzu, Laudse, Lau-dse), die Referenzperson des
Daoismus, dem Brecht das Gedicht "Legende von der
Entstehung des Buches Taoteking auf dem Weg des Laotse
in die Emigration" (1938) widmete. Die Botschaft des
Brechtschen Gedichtes ist, dass ohne Fragende, ohne
Schüler auch der Weise, auch der beste Lehrer spurlos
vergehe. Von der Lehre des Laozi teilt uns Brecht, aus
dem Munde eines Knaben, der den Ochsen des Reisenden
führt, mit: "Daß das weiche Wasser in Bewegung/Mit der
Zeit den harten Stein besiegt."
Die in China verbreiteten Legenden vom Leben des Laozi
nennen für sein Wirken den Beginn der "Zeit der
Frühlings- und Herbstannalen", als die ersten bekannten
chinesischen Philosophenschulen sich um die Lehre der
richtigen Staatsführung im Lernen aus der Geschichte
bemühten. Laozi sei in dieser Zeit als Archivar am Hof
von Zhou beschäftigt gewesen und auch als besonders
gelehrt in den Philosophenschulen gerühmt worden. Einmal
sei der junge Kongzi/Konfuzius (551-479) zu ihm
gekommen, habe aber keine ihn befriedigenden Antworten
auf seine Fragen bekommen und sei enttäuscht wieder
abgereist. Bald darauf habe Laozi den Hof verlassen, um
sich auf Wanderschaft ("Emigration" ist eine Deutung
Brechts) zu begeben. Die chinesische Überlieferung
spricht von einem Wasserbüffel, auf dem Laozi gereist
sei. Unterwegs habe er auf die Bitte eines Grenzwächters
hin seine Lehre, das Daodejing niedergeschrieben.
Angedeutet wird auch, dass er auf seiner Wanderung
später an den Ganges gekommen sei und dort den Buddha
(563-483 nach der "Langen Chronologie") getroffen habe.
Und in der Tat gibt es zwischen dem frühen Buddhismus
und dem Daoismus signifikante Übereinstimungen.
Ob es Laozi als reale Person wirklich gab ist
umstritten. Möglicherweise ist er eine Erfindung der
Daoisten, die im 3. Jahrhundert mit den
Konfuziusanhängern um die Vorherrschaft im politischen
Beratergewerbe rangen - als Vertreter der "reinen" Lehre
des Dao gegenüber seiner Formalisierung im
Konfuzianismus. Die historischen Belege und die
Rezeption in China sprechen dafür, dass es sich beim
Daodejing um eine Sammlung überlieferter Weisheiten
verschiedener Eremiten, Geschichtsschreiber und
Philosophen handelt, die erst um 300 v. Chr. kanonisiert
wurde, möglicherweise durch Zhuangzi (365-290). Über das
Dao sagt Zhuangzi (in der Übersetzung von Thomas
Merton/Johann Hoffmann-Herreros): "'Tao' sagen, ist: ein
'Nicht-Ding' nennen. Tao ist nicht der Name von etwas,
'was existiert'."
Das Daodejing beginnt mit einem Epigramm aus zwei
Sätzen. Der erste Satz sagt uns über den "Weg", die
Wegleitung, das richtige Leben, die gelingende
Staatsführung, die Methode der Wahrheitsfindung, das
Dao, dass wir im Rahmen der Identitätslogik nichts über
das Dao aussagen können. Dies wird im folgenden Satz
auch über die Anrufung/die Namen der Dinge/des Seienden
gesagt. Gemeinhin wird dies übersetzt im Sinne von: Was
immer wir über das Dao sagen können, erfasst dieses
nicht. Was immer wir über die Namen des Seienden sagen,
erfasst diese nicht.
Der Daoismus wird in der westlichen Rezeption als
naturphilosophisches Konstrukt verstanden. Der Theologe,
Missionar, Pädagoge und Sinologe Richard Wilhelm hat
schon früh entschieden darauf aufmerksam gemacht, dass
der Daoismus nicht zu reduzieren ist auf die Lehre des
Daodejing, welche als eine moralphilosophische Umsetzung
des älteren Daoismus verstanden werden kann. Von
Interesse für uns heute ist die Ableitung einer
Morallehre aus naturphilosophischen Prinzipien, was dem
westlichen Denken keineswegs fremd, aber doch etwas
verdächtig ist. Schon bei Heraklit finden sich Ansätze
dazu, Empedokles führte dies begrifflich stringenter
aus, Epikur hat dergleichen unternommen, Spinoza
entwickelte dies aus seiner Formel "deus sive natura",
aktuell arbeiten naturethische Positionen sich daran ab.
Die beiden ersten Epigramme machen deutlich, wo der Link
zwischen Naturphilosophie und Moralphilosophie zu sehen
ist. Was in westlicher Philosophie Geist, Erstes
Prinzip, Erster Beweger wäre, in westlicher Religion der
unsagbare Gott, Demiurg und Bewahrer, ist hier das Dao,
ein Prinzip, das sich selbst sein Anderes ist, das
keinen Satan, keinen Sündenfall, keine Materie als sein
Anderes fordert, an dem es arbeiten muss, gegen das es
sich zu behaupten hat als Herr und Meister. Der Weg, das
Dao ist auch der Nicht-Weg. Die begriffliche Welt ist
auch die unbegreifbare Welt. Der Daoismus bietet einen
Ansatz, Natur nicht als defizitär, als
erlösungsbedürftig, als durch den Menschen zu seiner
Erfüllung zu bringendes Mängelwesen zu lesen, sondern
als Lehrwerk - auch für ein Moralsystem, das nicht auf
Strafen oder Erziehen abhebt, sondern auf
Folgerichtigkeit und Ausgleich. Dabei werden die
Grundprinzipien des Naturprozesses zur Anleitung, nicht,
wie in jüngerer Zeit bisweilen in popularisierter
Verhaltensforschung, das Verhalten von Tieren.
Lektüreempfehlung:
Thomas Merton, Sinfonie für einen Seevogel. Geschichten
und Meditationen des Zhuangzi, Ostfildern: Patmos, 2012
|
|
Empedokles und das
"Bewußtsein der Verwandtschaft"
Wir sind es gewohnt, die Lehre von der
Seelenwanderung als dem westlichen Denken fremd
anzusehen. Doch bei den Orphikern und einigen
Vorsokratikern gab es auch in der griechischen Antike
ausgeprägte Konzeptionen zur Reinkarnation - etwa
zeitgleich mit den maßgeblichen Lehrströmungen in
Hinduismus und Buddhismus. Wirksam blieben sie bis
Platon, mit jüdischen und später christlichen
Vorstellungen waren sie nicht vereinbar.
Wir kennen, neben der widersprüchlich überlieferten
Lehre der Pythagoreer, vor allem die Wiedergeburtslehre
des Empedokles, die in seiner nur in Bruchstücken
sekundär überlieferten Ethik ("Reinigungen", zwei
Bücher) vorgestellt wird und die in seiner teilweise im
Original überlieferten Naturphilosophie ("Physik", drei
Bücher) eine gewisse theoretische Grundlegung erfährt,
was seine Theoriekonstruktion besonders interessant
macht für den Diskurs des menschlichen
Naturverhältnisses. Das erste Buch der Physik,
bruchstückhaft überliefert vor allem durch Simplikios
und im "Straßburger Papyrus", enthält die Lehre, wonach
es kein wirkliches Werden und Vergehen gebe, sondern
lediglich eine Neuzusammensetzung und Trennung der vier
Urstoffe, Elemente Feuer, Erde, Luft und Wasser.
Zusammensetzung/Vereinigung und Trennung werden dabei
geleistet von den beiden Urkräften Liebe (philia,
philotes) und Haß (neikos , neikeos, neikeos echthei).
Damit skizziert Empedokles eine Naturtheorie, die nicht
in eine materielle und eine spirituelle Welt trennt,
nicht in Schöpfer und Schöpfung.
Allerdings gefährdet er seinen Ansatz in der Morallehre
mit der unklaren Bestimmung dessen, was sich (nach
heutiger Vorstellung) beim Gang der Reinkarnationen
bewahrt als das Reinkarnierte. Er führt lediglich aus,
dass es der "Haß" (so wird "neikos" bei Empedokles meist
übersetzt - die Bedeutung ist auch "Streit",
"Zwietracht") sei, der Wiedergeburten antreibe. Es ist
daher problematisch, seine Lehre als Reinkarnationslehre
zu charakterisieren und zu eng vom Modell der Orphik her
zu deuten. Wenn etwa Heraklit den Zwiespalt (polemos)
als Vater aller Dinge bestimmt, meint er keine zu
überwindende böse Macht, sondern ein schöpferisches
Prinzip (falls wir nicht die Deutung bevorzugen, er habe
nur konkret politisch den Krieg gemeint). Und davon
zehrt auch die Lehre des Empedokles, auch wenn er dem
Haß lediglich zuspricht, die Elemente für den
schöpferischen Prozess stets neu bereit zu stellen.
Dem Haß beigesellt ist die Liebe, die aus den Teilen
immer wieder ein neues Ganzes fügt. Als historische
Referenz für ihre Kraft zitierte Empedokles in Fragment
128 das "Goldene Zeitalter", das bei ihm klar
matriarchalische Züge trägt, mit der "Liebe" (Kypris,
philia) als Herrscherin: "Da wurde kein Altar mit
gräulichem Stierblut besudelt, sondern das galt damals
bei den Menschen als der größte Frevel, einem andern
Wesen das Leben zu rauben und seine edlen Glieder
hinunterzuschlingen." Empedokles wendet sich
also entschieden gegen das Töten und Verspeisen von
Tieren als barbarische Akte und begründet dies explizit
aus seiner Wiedergeburtslehre, etwa im Fragment 137:
"Der Vater hebt den eigenen Sohn auf, der eine andere
Gestalt angenommen hat, schlachtet ihn und spricht das
Gebet dazu (...). In genau derselben Weise ergreifen den
Vater der Sohn und die Mutter ihre Kinder, rauben ihnen
mit Gewalt das Leben und verspeisen das Fleisch der
Verwandten."
Was
Empedokles über das Goldene Zeitalter sagt, ist
überliefert vor allem in einem Fragment des Theophrast
(374/369-288/285). Dort findet sich eine Formulierung,
die aus Sicht aktueller Diskurse um Tierrechte und
"Bewahrung der Schöpfung" von brennender Aktualität als
- vergessenes - kulturelles Erbe des sogenannten
"Abendlandes" wird: "Als nämlich, wie ich meine, die
Liebe (Philia), und das heißt das Bewußtsein der
Verwandtschaft (to syggenes aistheseos), alles
beherrschte, mordete niemand etwas, weil man die übrigen
Lebewesen als verwandt betrachtete." (Mansfeld 1987, S.
477).
Die Spannung zwischen Physik und
Ethik des Empedokles wird in der Forschung oft als
Ausdruck eines Leib-Seele-Dualismus in seiner Lehre
gesehen - so vor allem bei Wilhelm Nestle 1906. Das
verleugnet jedoch die Ansätze in der Philosophie des
Empedokles, diesen bei den Orphikern und anderen
zelebrierten Dualismus aufzuheben und damit der
materiellen Naturwelt Eigenwert zuzusprechen bzw. sie
als unablösbaren Anteil der Menschenwelt anzusehen. Die
Wiedergeburtslehre des Empedokles mündet in einer
Wiederkehr des Goldenen Zeitalters durch eine
Verlagerung in der Gewichtung der beiden Urprinzipien
Liebe und Streit zugunsten der Liebe, nicht durch eine
Vernichtung des antagonistischen Prinzips. Darauf hat
mit Nachdruck Jaap Mansfeld bereits 1987 und erneut -
etwas abgeschwächt - 2011 (gemeinsam mit Oliver
Primavesi) in den Reclam-Ausgaben vorsokratischer Texte
hingewiesen (Mansfeld 1987, S. 390 et pass.,
Mansfeld/Primavesi 2011, S. 408).
Bemerkenswert ist auch, dass Empedokles seine Naturlehre
verknüpft mit der Einordnung der Götterwelt in den
Schöpfungsprozess als geschaffene Wesen unter anderen -
lediglich mit besonderer Lebensdauer, "langlebig" -
Physika I, 269-272 (Straßburger Papyrus). Das
wiederkehrende Goldene Zeitalter als Reich der
Liebesherrschaft bei Empedokles stellt in seiner
philosophischen Durchdringung ein wichtiges Bindeglied
dar zwischen mythologischen Vorstellungen und der
christlichen Lehre bzw. auf ihr basierenden
chiliastischen Konzeptionen etwa bei Joachim von Fiore
und späteren philosophischen Konzeptionen im Deutschen
Idealismus.
Friedrich Hölderling macht den Philosophen in seinem
Drama "Der Tod des Empedokles" zu einem Charakter, der
durch sein Wirken eine Ahnung vom Goldenen Zeitalter zu
geben vermochte, der im Einklang mit der Natur lebte,
aber an seinen eigenen Ansprüchen und dem Versuch einer
politischen Umsetzung seiner Ideale scheiterte.
Lektüreempfehlungen:
Maria Laura Gemelli
Marciano, Die Vorsokratiker, Bd. II, 2009. Jaap
Mansfeld/Oliver Primavesi, Die Vorsokratiker, 2011
|
|
Platons
Atlantis-Berichte
Die beiden späten Dialoge "Timaios" und
"Kritias" (vermutlich nach 360 v. Chr. entstanden)
enthalten Platons Thematisierung des Atlantis-Mythos,
wobei "Kritias" gar den Nebentitel "Atlantikos" trägt.
"Kritias" wurde nach "Timaios" geschrieben und verweist
ausdrücklich auf das bereits im "Timaios" Gesagte
(108e).
Im "Timaios" beginnt die Atlantis-Erzählung mit einem
Bericht des Solon von einer Ägyptenreise. Dort haben ihm
die Priester von Saïs Geschichten über die "alten
Zeiten" der Stadt Athen erzählt. Zunächst erwähnen sie
kurz die Deukalionische Flut und den nachfolgenden
Neuanfang durch Deukalion und Pyrrha (22a, 22b). Dann
folgt eine grundlegende Reflexion über die "(v)iele(n)
und mannigfache(n) Vernichtungen der Menschen", z.B. die
im Phaëton-Mythos berichtete durch "eine Abweichung der
am Himmel um die Erde kreisenden Sterne" - lesbar als
Meteoriteneinschlag oder erhöhte Sonnenaktivität (22c,
22d). Der "Timaios" beschreibt auch in Grundzügen die
Topographie von Atlantis und ihre Position im Atlantik.
Im "Kritias" wird das Staatswesen der Atlantiden
differenziert beschrieben, vor allem aber wird die
Gesellschaft der Ur-Griechen und ihre militärische
Auseinandersetzung mit den Atlantiden geschildert, als
diese Richtung 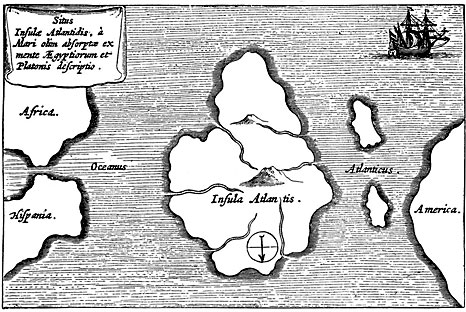 Europa
und Asien expandierten. Dabei wurden sie von den
Griechen, insbesondere den Athenern, erfolgreich
gestoppt - ehe Attika teils und Atlantis vollständig
durch eine Naturkatastrophe zerstört wurden. Europa
und Asien expandierten. Dabei wurden sie von den
Griechen, insbesondere den Athenern, erfolgreich
gestoppt - ehe Attika teils und Atlantis vollständig
durch eine Naturkatastrophe zerstört wurden.
Die Atlantis-Erzählung bei Platon wird heute in den
Wissenschaften vorwiegend gedeutet als Versuch Platons,
seine eigenen Staats- und Gesellschaftsauffassung durch
einen fiktiven historischen Bezug zu legitimieren. Als
Tatsachenberichte wurden die beiden Texte bislang
vor allem von Atlantis-Erforschern aufgefasst, von
Athanasius Kircher über Ignatius Donelly und Paul
Schliemann bis Charles Berlitz. Ex negativo lässt sich
die geringe Neigung der zeitgenössischen
Wissenschaftsgemeinde, Platons Ausführungen wörtlich zu
nehmen, auch begründen durch die massive Erschütterung,
die dies für die Fortschrittsidee bedeutet. Die
Vorstellung, unsere kulturelle Entwicklung sei als
weitgehend kontinuierlicher Anstieg von Wissen und
Kunstfertigkeit - mit gelegentlichen Rückschlägen - zu
verstehen, steht eher hilflos vor Berichten, wonach
unsere Vorfahren mehrmals die Schrift und damit
verbunden eine Hochkultur erlernt und wieder
vergessen/verloren haben.
Insbesondere gibt uns dies für die Zukunft erhebliche
Unsicherheiten. Bei der Umsetzung wissenschaftlicher
Erkenntnisse in risikobehaftete wirtschaftliche Projekte
wird angesichts ungelöster Probleme (Endlagerung
radioaktiver Abfälle, Rückbau oder Kontrolle
stillgelegter Atommeiler, Ersetzung verbrauchter
Ressourcen, Plastikmüllentsorgung etc.) stets darauf
verwiesen, dass die Menschheit bei der zu erwartenden
weiteren Entwicklung diese Probleme selbstredend
erfolgreich lösen werde. Platon erschüttert diesen
Glauben mit seiner Atlantis-Geschichte nachdrücklich,
hält jedoch am Sinn der Bemühungen um eine Verbesserung
der Verhältnisse fest. Dies mit einem Projekt
gesellschaftlicher Organisation, das anmutet wie die
Wiederinstallation eines historisch für den
Mittelmeerraum überholten Kastensystems, das es den
"alten" Griechen - 9.000 Jahre vor Platon, zum Beginn
der präborealen Oszillation mit einem
Meeresspiegelanstieg von ca. 9 Metern! - ermöglicht
habe, gegen die Heeresmacht der Atlantiden zu bestehen.
Die Entsprechungen in den diversen Sintflut-Legenden und
vor allem die Koinzidenz mit dem Beginn der präborealen
Oszillation sind durchaus Argumente dafür, hinter den
Platonschen Atlantis-Berichten einen historischen
Wahrheitskern zu vermuten. Dass Platon die historische
Überlieferung - sofern es sie tatsächlich gab - für sein
ideologisches Anliegen zupass kam und entsprechend von
ihm überformt und ausgestaltet wurde, ist anzunehmen.
Bislang fehlen allerdings hinreichende archäologische
Evidenzen. Was gegen die Existenz einer Hochkultur mit
Ausstrahlung in den Mittelmeerraum in der Zeit um 10.000
vor Christus spricht, ist auch das Fehlen entsprechender
Befunde aus Ägypten, dem Land, das laut Platon die
Erinnerung an Atlantis und die zeitgleich lebenden
hochentwickelten Ur-Griechen bewahrte.
In unserem Kontext sind Platons Berichte vor allem
aufschlussreich als Zeugnisse eines intensiven
Bewußtseins von der Verletzlichkeit menschlicher
Zivilisation, ihrer Abhängigkeit von Naturprozessen, von
Veränderungen der Umweltbedingungen und Katastrophen
natürlichen Ursprungs.
Abbildung:
Atlantis-Karte von Athanasius Kircher, aus seinem
"Mundus subterraneus", 1664-68 - Norden liegt unten.
|
|
Lukrez: Natur als
Stoffkreislauf
Die junge christliche Kirche hat ihn nicht
gemocht. Kirchenvater Hieronymus schreibt zu Lukrez
(99-55 v. Chr.), er sei durch einen Liebestrank
wahnsinnig geworden und habe sich mit 44 Jahren das
Leben genommen. Der Selbstmord wird auch in anderen
Quellen angeführt, ansonsten wissen wir wenig über das
Leben des Philosophen. Der von Hieronymus genannte
"Liebestrank" verweist eher auf die Kategorie übler
Nachrede denn auf einen Lebensbericht. Mit der
Möglichkeit des Selbstmordes beschäftigt sich Lukrez im
3. Buch von De rerum natura (rer. nat.). Das ganze Buch
gilt der Einheit von Seele und Körper und dem Thema des
Todes, vor dem sich zu fürchten unsinnig sei. Es gebe
keinen "Tartarus" in den zu stürzen nach dem Tode wir
erwarten müssten (rer. nat. 3, 966). Später im Buch
bringt Lukrez Beispiele von Menschen, die sich wegen
Krankheit oder Altersermattung ruhig selbst den Tod
gegeben haben. So etwa Demokrit (rer. nat. 3, 1039ff),
der beim Nachlassen seines Gedächtnisses im hohen Alter
(heute nennen wir das "Demenz") den Tod vorzog. Demokrit
wurde etwa 90 Jahre alt.
Demokrits Lehre war, vermittelt über Epikur, Vorbild der
Atomlehre des Lukrez, die in "De rerum natura"
entwickelt wird. Für Lukrez besteht die ganze Welt,
einschließlich der Seele, aus Atomen. Auch Gedanken
seien nichts weiter als Bewegungen von Atomen. Im ersten
Buch werden die Grundlagen seiner Atomlehre entwickelt.
Interessanterweise wird dabei zunächst die Göttin Venus
angerufen und gepriesen. Sie solle den Dichter und
Denker segnen und begleiten bei seiner Arbeit, auf dass
diese erfolgreich und gehört werde. Allerdings ist Venus
kein Prinzip in der Lehre des Lukrez. Bei ihm gibt es
nur die Atome als Urbausteine, die in stetem Wechsel neu
formiert werden. Über das organisierende Prinzip hüllt
er sich in Schweigen. Ganz zu Beginn erscheint in einer
poetischen Wendung die "Künstlerin Erde/daedala tellus"
(rer. nat. 1, 7), die Blumen hervorbringe. Ansonsten
spricht er von der "natura", erklärt jedoch nicht
weiter, wie diese Atome zu steuern und zu strukturieren
vermag. Er bemüht sich vielmehr, die Weltdinge rein
deskriptiv zu erfassen und ohne Rekurs auf Götter und
Dämonen. Wo der Erklärungsbedarf drängend wird, verweist
er lakonisch auf "Samen/semine".
Prämisse seiner Lehre ist, dass nichts aus Nichts
entstehen könne, dies gelte für jedes Ding. "Denn
entstünde es aus Nichts, so könnt aus jeglichem Dinge
jegliche Gattung entstehn und nichts bedürfte des
Samens." (rer. nat. 1, 19). Nebenbei findet sich dieser
Gedanke auch bei Empedokles in Vers 261ff des ersten
Buches seiner Physik. An Empedokles kritisiert Lukrez,
dass er sich auf lediglich vier Elemente stütze, Luft,
Erde, Wasser und Feuer. Er hebt ihn jedoch weit über die
anderen Vorsokratiker hinaus und beschäftigt sich
eingehend mit ihm (rer. nat. 1, 716ff).
|
|
"Natur" im Neuen Testament
Im Neuen Testament kommt Natur im
allgemeinen Sinne von natürlicher Umwelt kaum vor. Wenn
sie komplex erscheint, so als bloße Kulisse, als
Inszenierungsangebot für Wunder, etwa beim Gehen über
Wasser und bei der Besänftigung eines Sturmes, oder in
Topoi der Leidensgeschichte als menschlich gestaltete
Natur, etwa im Garten Gethsemane. Individualisierte
Naturphänomene dienen häufig positiv als Bild für
Christus oder seine Anhänger, wobei Weinstock und
Ölbaum, also zwei der wichtigsten Kulturpflanzen,
dominieren. Gelegentlich ist ein negativer Bezug
auffallend, so wird ein Feigenbaum verflucht, da er
keine Früchte trage (Markus 11,14) und Schweine werden
zum Blitzableiter für das Böse (Markus 5,13). Wobei wir
auch hier von gleichnishaft-bildlicher Rede ausgehen
müssen, bei der Deutung des Sachbezuges ist also
Vorsicht geboten.
Konzeptionell erscheint Natur gelegentlich im Neuen
Testament im Sinne einer allgemein Naturordnung - mit
deutlich kultureller Formatierung. So etwa in Römer
11,24, wo ein "von Natur" ("kata physin") wilder Ölzweig
"wider die Natur" ("para physin") auf einen veredelten
gepropft wird. Thematisiert wird als Teil dieser Ordnung
auch die "menschliche Natur" in einem diffus
biologisch-sozialen Referenzrahmen. Dies geschieht
zumeist in lehrhaften Kontexten, was nicht erstaunt
angesichts der dezidiert gesellschaftlich-sozialen
Ausrichtung schon des frühen Christentums.
Zur Natur des Menschen äußern sich die Evangelisten in
jenem bekannten "Der Geist ist willig, aber das Fleisch
ist schwach." So etwa in Markus 14,38 ("To men pneuma
prothumon he de sarx asthenes." Die Verbindung von
"fleischlich" und "menschlich" stellt der 1.
Korintherbrief 3,3 her: "Eti gar sarkikoi este hopou gar
en hymin selos kai eris kai dichostasiai ouchi sarkikoi
este kai kata anthropon." Sündiges Fleisch, leibliche
Lüste, Fleischgenuss (wobei unklar bleibt, ob nur
Opferfleisch gemeint ist oder Tierfleisch allgemein)
sind zentrale kritische Themen im Römerbrief wie im
ersten Korintherbrief. "Menschliche Natur" ist damit
aufs engste assoziiert. Es ist daher wenig überzeugend,
wenn die Lust- und Leibfeindlichkeit des Christentums,
wie häufig geschieht, erst auf Augustinus zurückgeführt
wird.
Im 1. Korintherbrief 11,14 werden lange
Haare bei Männern gezeichnet als gegen das gerichtet,
was die Natur lehrt ("he physis didaskei") - was
bemerkenswerterweise keinen Einfluss auf die späteren
Jesusdarstellungen hatte. Gelegentlich werden auch
einander gegenübergestellt das Geistige ("to
pneumatikon") und das seelische-sinnlich-naturhafte
("to psychikon") - so 1. Korintherbrief 15,46. Dass
Menschen auch von Natur ("physei") gut handeln können,
lehrt Römer 2,14.
|
|
Natur/Schöpfung als
Erlösungswerk im Manichäismus
Im Manichäismus erscheint Natur als Phänomen
einer zweiten Schöpfung, welche nach dem Sieg der
Dunkelheit über den Urmenschen/Lichtgott Ohrmizd (Ahura
Mazda) anhob, um die Befreiung der Lichtteile aus der
Gefangenschaft in Finsternis zu leisten. Als Abschluss
der zweiten Schöpfung wurde der Mensch geschaffen, "nach
Form und Gestalt der Götter", vordergründig im Dienste
der bösen Gottheit Az stehend, die in einer dem
Šābuhragān, Manis grundlegender Lehrschrift,
zugesprochenen Handschrift (M 7983) verkündet:
"Ich habe Erde und Himmel, Sonne und Mond, Wasser und
Feuer, Bäume und Pflanzen, wilde und zahme Tiere
euretwegen geschaffen, damit ihr dadurch in der Welt
froh, glücklich und erfreut werdet und meinen Willen
tut." (Handschrift M 7983, Zeilen 1139-1148,
zitiert nach Hutter 1992, S. 96)
Az schafft die Welt als Gefängnis des Lichtes.
Allerdings legen andere Grundtexte des Manichäismus
nahe, dass sie dies nach dem Plan einer Urgottheit tut,
deren Ziel es ist, die Lichtteilchen wieder zu befreien.
Was es bedeutet, den Willen der Az zu erfüllen, zeigen
die Ausführungen zu den Handlungen der ersten Menschen
einige Zeilen später:
"Als dann der 'Erste Mensch' und die 'Weibliche der
Glorien', der erste Mann und die erste Frau, begannen,
auf der Erde zu verweilen, da erwachte die Az in
ihnen, und Zorn erfüllte sie. Und sie begannen,
Quellen zu verstopfen, Bäume und Pflanzen zu schlagen,
rasend auf der Erde zu verweilen und gierig zu werden.
Vor den Göttern aber fürchten sie sich nicht."
(Handschrift M 7983, Zeilen 1171-1186)
Nichts also hören wir hier von Paradies und Sündenfall.
Von Anbeginn sind die Menschen dem Bösen, Az, verfallen
- es scheint gar, sie wurden von ihm geschaffen. Über
die Entwicklung des Menschen nach der Geburt heißt es in
einer Abhandlung über das Verhältnis von Körper und
Seele ganz analog in der gleichen Handschrift:
"Und Wasser, Feuer, Bäume und die Geschöpfe, seine
eigene Familie, schlägt und quält er. Und Az und
Sinnenlust werden durch ihn froh, denn ihren Willen
und (ihre) Weisung erfüllt er. Aber weder Wasser noch
Feuer noch Bäume noch Geschöpfe werden durch ihn froh.
Denn er wird ihr Feind und Quäler. Und nicht hört er,
denn Az hält ihn bewußtlos und 'schlechtseelig'."
(Handschrift M 7983, Zeilen 1213-1229, zitiert nach
Hutter 1992, S. 107)
In Verkennung seiner ihm nach Manis Auffassung
zugedachten Aufgabe sieht der Mensch zunächst die
Schöpfung als Verfügungsmasse an. Und wird darob von
Mani in einer Weise gerügt, die wenige Parallelen in der
Kulturgeschichte hat. Am ehesten etwa 1.220 Jahre später
im "Iudicium Iovis" von Paulus Niavis (siehe einige
Kapitel weiter unten). Im "Sermon von der Seele",
einem frühen Text des östlichen Manichäismus, müssen die
Menschen, die den fünf Elementargöttern (Luft/Äther,
Wind, Licht, Wasser, Feuer) Schaden zufügen, zur Hölle
fahren (Sundermann 1991, S. 15).
Der Manichäismus wendet das biblische "Macht Euch die
Erde untertan" ganz entschieden kritisch. Als frühe
Formulierung ökologischer Anliegen taugen die bislang
erschlossenen einschlägigen Lehrpassagen allerdings nur
bedingt. Zu allgemein bleiben die Aussagen und nur
unklar erscheint eine Gegenposition. Der Vorwurf,
"Pflanzen zu schlagen", macht auch eine vegetarische
Ernährung problematisch, um nur ein Beispiel zu nennen.
Als eigentliche Aufgabe des Menschen erscheint im
Manichäismus nicht eine "Bewahrung der Schöpfung" im
heutigen Verständnis, sondern die Erfüllung der
Schöpfung durch die Befreiung der Lichtteile aus der
Verhaftung in dunkler Materie. Dies geschehe etwa durch
die Ernährungsweise der Erwählten - wobei Ernährung
dreifach zu verstehen ist, durch Nahrungsmittel,
kosmische Einflüsse und Sinneswahrnehmungen. Wir dürfen
allerdings vermuten, dass einem zeitgenössischen
Manichäismus Slow Food näher stünde als Fast Food,
erneuerbare Energien näher als Kohle- oder
Atomkraftwerke und Naturparks näher als Freizeitparks.
Die Mahnung zu einem behutsamen Naturumgang sollte nicht
darüber hinwegsehen lassen, dass die menschliche Natur
im Manichäismus umfassend abgeurteilt und negativ
gezeichnet wird: "Und in ihn (den männlichen Körper
Gehmurds/Adams, ähnlich sind die Ausführungen zum
weiblichen Körper Murdiyanags/Evas - H.Sch.) wurden
hineingelegt ihre Gier und Sinnlichkeit, Geilheit und
Koitus, Feindseligkeit und Verleumdung, Neid und
Sündhaftigkeit, Zorn und Unreinheit, ? und
Bewußtlosigkeit, Behaftetsein mit einer schlechten Seele
und Zweifel, Diebstahl und Lüge, Grausamkeit und übles
Handeln, Hartnäckigkeit (?) und ?, Rache und ?, Qual und
Kummer, Schmerz und Zahnweh, Armut und Betteln,
Krankheit und Alter, Stinken und Räuberei (?). Und
(auch) jene verschiedenen Sprachen und Stimmen der
Ungeheuermißgeburten, aus denen jener Körper gebildet
war, gab sie dem Geschöpf, auf daß es die
verschiedenartigen Sprachen spreche und verstehe."
(Böhlig 1995, S. 115).
Lektüreempfehlungen: Manfred Hutter, Manis kosmogonische
Šābuhragān-Texte, Wiesbaden: Harrassowitz, 1992. Werner
Sundermann, Der Sermon von der Seele, Opladen:
Westdeutscher Verlag, 1991. Alexander Böhlig (Übers.),
Die Gnosis. Der Manichäismus, München/Zürich: Artemis
& Winkler, 1995
|
|
Die Welt als
Garten I: Der christliche Klostergarten
Das Christentum ist über den verlorenen
Paradiesesgarten des Alten Testamentes mit dem
Gartenthema signifikant verbunden. Doch im Neuen
Testament erscheint das Thema kaum. Einzig der Garten
Gethsemane, der Garten der Ölpresse, hat herausragende
Bedeutung - in der Leidensgeschichte Jesu. Erst mit der
Regula Benedicti, 66.6, wird der Garten zu einem
prägnanten Bild im Christentum, als zentraler
Bestandteil monastischer Lebensführung. Die Regel 66
handelt von der Autarkie des Klosters, die unter anderem
durch einen eigenen Garten ("hortus") gesichert werden
solle, um die Mönche von jeder äußerlich-weltlichen
Zerstreuung abzuhalten. Damit begann die
Erfolgsgeschichte christlicher Klöster als Zentren der
landwirtschaftlich-gärtnerischen Entwicklung, in der
insbesondere die Benediktiner und ihre
reformistisch-strengeren Abkömmlinge, Zisterzienser und
Trappisten, sich auszeichneten. So wurde beispielsweise
das Wissen um den Olivenanbau am nördlichen Mittelmeer
während der mittelalterlichen Kältezeit in
Benediktinerklöstern bewahrt und der Olivenanbau dann in
der spätmittelalterlichen Wärmezeit von diesen
Klöstern ausgehend neu belebt.
Klöster entstanden häufig auf Rodungsinseln, mit welchen
die Klostergründungen auch zu Pionieren in der
Erschließung noch unbesiedelter Regionen wurden. Damit
konnten sie anschließen an Josua 17,18 - im Zuge
der Eroberung kanaitischer Gebiete wurde dem Stamm
Josephs ein Berggebiet zur Rodung übergeben. Die erste
Benediktinergründung auf dem Monte Cassino 529/540 wurde
exemplarisch, angelegt im Bereich eines ehemaligen
Apollotempels und einer römischen Befestigungsanlage,
zerstört 577 (Langobarden), neu besiedelt 717, erneut
zerstört 883 (Sarazenen) und im Gefolge immer wieder
aufgrund seiner strategisch bedeutsamen Lage umkämpft.
Die benediktinische Regel des "ora et labora" befreit
die Arbeit (als Arbeit mit den Händen, am natürlich
Vorhandenen), von dem Makel, der ihr insbesondere in der
griechischen Stadtkultur anhaftete und den Judentum wie
Christentum mit der Strafe nach dem Sündenfall ("im
Schweiße deines Angesichts") verbanden. Dafür hatte
bereits Augustinus in "De Genesi ad litteram" 8,8 die
Voraussetzungen geschaffen, indem er darauf hinwies,
dass auch vor dem Sündenfall gearbeitet wurde, jedoch
als Mitarbeit an der Schöpfung Gottes. Ein Ansatz, den
das Mönchstum für seine Arbeit gleichfalls reklamierte.
Insbesondere der Klostergarten sollte so zu einem
Spiegelbild des Paradiesgartens werden. Ein "Paradies
auf Erden" zu schaffen, war also nicht erst die Idee
chiliastischer Strömungen von Joachim über die Quäker
und andere protestantische Gruppen bis zu Teilen des
Marxismus. Interessant ist der Unterschied zwischen
östlichem und westlichem Mönchstum, auf den Udo Krolzik
hingewiesen hat: Während im östlichen Mönchstum auch
sinnlose Arbeit als hilfreich auf dem Weg zum Heil
angesehen wurde, gab es im westlichen Mönchtum (das
diese Auffassung durchaus auch kannte) eine starke
Tendenz, sinnlose Arbeit zu vermeiden und ermüdende
Arbeit durch Maschinen zu ersetzen, so ist bereits aus
dem 6. Jahrhundert etwa der Ersatz von Getreidemahlen
per Hand im Kloster durch eine Wassermühle dokumentiert
(Krolzik 1979, S. 179).
Gut dokumentiert ist der Beitrag der
Benediktinergründungen zwischen dem 7. und dem 10.
Jahrhundert zur Kultivierung Österreichs. Die
Ungarneinfälle brachten Rückschläge, doch ab 1060
expandierten die Klöster erneut und leisteten dann vor
allem in der Barockzeit einen wesentlichen Beitrag zur
Entwicklung und Stabilisierung des Habsburgerreiches,
dessen Gärten heute gelegentlich als Ausdruck einer
"Gartenmanie" der Habsburger gewertet werden. Referenz
der österreichischen Feudalgärten waren dabei unter
anderem die barocken Gartenanlagen des
Benediktinerstiftes Melk, die ideologisch den
Paradiesgarten, praktisch unter anderem den englischen
Landschaftsgarten zitierten.
Lektüreempfehlung: Udo Krolzik, 'Macht
Euch die Erde untertan ...!' und das christliche
Arbeitsethos. In: Klaus M. Meyer-Abich: Frieden mit der
Natur, 1979
|
|
Die Welt als
Garten II: Gärten des Islam
610 Jahre nach Christi Geburt und vier
Generationen nach der Gründung des ersten christlichen
Klosters auf dem Monte Cassino hat der Begründer des
Islam, Mohammed ibn Abd Allah, nach eigenem Bericht sein
Erweckungserlebnis, während des Ramadan, des "heißen
Monats" im arabischen Kalender. Die Gestaltung dieses
Erlebnisses in der Sure 96 zeigt das Vorbild der
Psalmen, Mohammeds Auftreten orientierte sich an den
Figuren von Mose und Jesus, die im Koran beständig
präsent sind, auch namentlich. Aufgewachsen im
multireligiösen Pilgerort Mekka, bei einem mit dem
Pilgerwesen beruflich befassten Großvater, war Mohammed
mit der jüdischen und mit der christlichen Überlieferung
bestens vertraut. Von ihnen übernahm er den radikalen
Monotheismus, den er verband mit einer Neubelebung des
Tieropfers und mit vormonotheistischen
Göttlichkeitsvorstellungen, die das Numinose als
andauernd in der Schöpfung tätig wirksam ansahen.
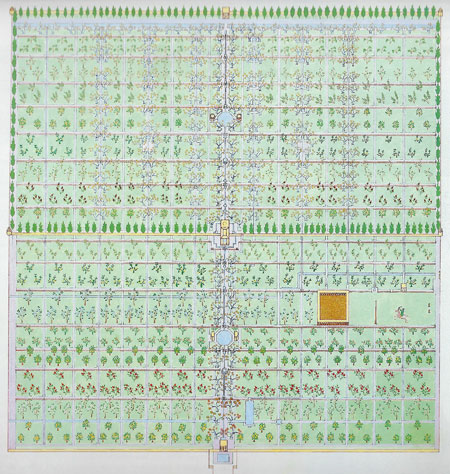
Die Auffassung der andauernden Präsenz des Schöpfers in
der Schöpfung bedingte eine andere Haltung zur
natürlichen Umwelt als sie das Christentum entwickelte.
Sie ist zu lesen vor dem Hintergrund, dass der Koran
beide Traditionen beerben und wenden wollte, die
christliche und die jüdische, als Erneuerung der
Religion Abrahams, wie Mohammed seine Sendung verstand.
Wo das Christentum zum Weltverhältnis auf das Alte
Testament verweisen konnte, beansprucht der Koran eine
eigenständige Position und Lehre. Dazu stammt der Koran
aus einer Region, die weit trockener war und
schwieriger zu bewirtschaften als die Levante. Ein
achtsamer Naturumgang, insbesondere mit der Ressource
Wasser, ergab sich als unabdingbar. Dies spiegelt sich
etwa in der Sura 4:119 wider. Dort ist es der Satan, der
bedinge, dass die Menschen, Ungläubige, die Schöpfung
verunstalten! In der Sura 55:10 wird deutlich gemacht,
dass die Schöpfung nicht für den Menschen alleine,
sondern für alle Geschöpfe gemacht sei.
Insbesondere das Bild des Gartens hat die
Naturauffassung des Islam nachhaltig geprägt. So finden
wir im Koran 150 Stellen zu Garten ("dschanna"), davon
59 Stellen zum Paradiesgarten als ursprünglicher
Behausung Adams und Evas sowie Erfüllungsort jenseitiger
Verheißung. In der Sura al-Baqara, 2:265, erscheint der
Garten als verheißungsvolles Bild für die Gläubigen, die
wohltätig sind nicht zur Selbsterhebung und des
gesellschaftlichen Ruhmes wegen, sondern einzig um Allah
zufrieden zu stellen und für sich selbst (anfusihim).
Dem gegenüber steht der Stein, der von einer Schicht
Muttererde überzogen ist, die bei Regen abgespült wird
(Sura 2:264) - während der Garten bei Regen reiche
Früchte trägt. Charakteristisch für den Garten im Koran
ist, dass ein Wasserlauf ihn durchzieht. Dies bestimmt
auch die realen Gärten des islamischen Kulturkreises,
die sich zudem durch eine streng
geometrisch-rechwinklige Anlage und eine Einfriedung
auszeichnen.
Eine hochentwickelte Gartenkultur gab es zur
Entstehungszeit des Islam im gesamten Orient.
Spektakuläre Anlagen waren allerdings an historisch
zurückliegende Machtkonzentrationen gebunden und lebten
zur Entstehungszeit des Islam nur noch in
Überlieferungen aus Altägypten, Babylon und Altpersien
fort. Eine Erinnerung daran bewahrte auch das hebräische
Wort für einen eingehegten Garten, Park, Hain:
"pardes/pardec" auf, das aus dem Altpersischen entlehnt
ist. Die Gartenwelt des vom Islam in den ersten
Jahrhunderten geprägten Kulturraums war durch arabische,
persische und türkische Traditionslinien beeinflusst.
"Drei Auffassungen von der Natur, von der Landschaft und
mithin vom Raum, von Anfang an konfliktär." (Petruccioli
1995, S. 9) Im 10. Jahrhundert wurde insbesondere und
modellgebend die feudale persische Gartenarchitektur
unter islamischen Vorzeichen neu belebt.
Das
größte Heiligtum des Islam ist der schwarze Quader der
Kaaba in Mekka, ein altes abrahamitisches Heiligtum
und nach islamischer Überzeugung von Abraham und
Ismael gemeinsam erbaut am ehemaligen Ort des
Paradiesgartens. Mekka selbst hat keinen
repräsentativen Garten (mehr?), allerdings den zentral
bedeutsamen Brunnen "Zamzam", dessen Quelle schon den
Paradiesgarten gewässert habe.
Abbildung: Rekonstruktion des Bagh-i Hizar Jarib in
Isfahan.
Lektüreempfehlung: Attilio
Petruccioli (Hrsg.), Der islamische Garten, Stuttgart
1995
|
|
Naturwissen
als Herrschaftswissen - das japanische Modell
Die seit der Verfassung
von 1947 nur noch mit repräsentativer Macht
ausgestattete Yamato-Dynastie in Japan, die älteste
Erbmonarchie der Welt, begründete im 4. und 5.
nachchristlichen Jahrhundert mit Hilfe chinesischer und
koreanischer Einwanderer ihre Macht durch die Übernahme
neuer Technologien in der landwirtschaftlichen
Bewässerung und im Militärwesen. Im 7. Jahrhundert
gestaltete die Dynastie nach chinesischem Vorbild
Verwaltung und Bildungswesen tiefgreifend um. In dieser
Zeit wurde auch der Titel "Tennô" (Beherrscher des
Himmels/Himmlischer Herrscher) installiert, ausgestattet
mit der Auffassung von der göttlichen Abkunft des
japanischen Kaisertums. Der Buddhismus wurde in diesem
Kontext faktisch zur Staatsreligion.
Den Untersuchungen des Japanologen
Christian Steineck/Raji C. Steineck zufolge, der an der
Universität Zürich lehrt, entwickelte sich in der
kulturellen Blüte des 8. Jahrhunderts in Japan eine
spezifische Auffassung von Naturwissen als
Herrschaftswissen. Das Bildungssystem war ganz den
Zwecken der Verwaltung und der Herrschaftsstabilisierung
untergeordnet. Naturprozesse mussten verstanden werden
als beherrschbar durch den Tennô - dies wurde umgesetzt
durch eine Verbindung des technischen Wissens mit dem
magischen Wissen, wie es in buddhistischen Klöstern
tradiert wurde. "So trieb man noch 1206 eine
unglückliche Planetenkonstellation auf Geheiß des Tennô
durch buddhistische Rituale auseinander" (Steineck 2010,
S. 31).
Dargestellt wird das Naturwissen der
Zeit Steineck zufolge in den beiden historiographischen
Werken Kojiki (712) und Nihonshoki (vor 735), zwei
konkurrierende Chroniken der japanischen Mythologie und
Urgeschichte, in einem Verzeichnis der Provinzen und
ihrer Besonderheiten mit dem Titel "Fudoki", in der
Gedichteanthologie Manyoshu, in buddhistischen Schriften
und in Gesetzen sowie Verwaltungsvorschriften. Ein
dominierender Naturbegriff lässt sich dabei nicht
greifen, aber doch eine stringende Auffassung von Natur
als dem Tennô und der gesellschaftlichen Funktionalität
unterworfenem Komplex.
Auf den ersten Blick abseits der
gesellschaftlichen Funktionalität scheint der
Naturbegriff zu stehen, der sich in den Gedichten der
Zeit widerspiegelt. Hier werden Empfindsamkeit für
Landschaftsbilder, für jahres- und tageszeitliche
Stimmungen und unscheinbare Naturgegebenheiten
zelebriert. Steineck sieht aber auch hier die "Technik
der Herrschaft" am Werk: "In einem wesentlich
anthropozentrischen Weltbild disponiert die rechte
Wahrnehmung der Umgebungsatmosphäre auch zum rechten
Handeln" (Steineck 2010, S. 31). Was nicht erstaunt,
waren die großen japanischen Dichter des 8. Jahrhunderts
doch oft hochrangige Mitglieder der Staatsverwaltung wie
Gouverneure oder Generäle. Andere gehörten in den
unmittelbaren Umkreis des Tennô als Hofdichter oder als
Hofdamen.
Konzeptionalisiert wird Natur in
verschiedenen Begriffen, von denen keiner den Gehalt der
"natura naturans" aufweist. Entsprechend fehlt auch ein
Konzept der "natura naturata". Der Begriff, der am
ehesten dem Begriff eines Naturganzens entspricht,
"tenchi", bedeutet "Himmel und Erde". Mit der Scheidung
der beiden beginnt, ähnlich wie im Alten Testament, die
Ordnung des Kosmos. Allerdings folgt dem nicht die
Schöpfung der Lebewesen mit dem Zielpunkt Mensch. Eine
Scheidung in belebte und unbelebte Natur kennt der
altjapanische Naturbegriff ebenso wenig wie eine
Hierarchisierung der Lebewesen. Herrscher der Natur ist
nicht der Mensch, sondern einzig der Tennô.
Lektüreempfehlung: Christian Steineck, Vormoderne
ostasiatische Naturbegriffe und ihre ethische Bedeutung.
In: Michael Fischer, Die Kulturabhängigkeit von
Begriffen, Ffm: Lang, 2010
|
|
Hildegard von
Bingen (1098-1179)
Die berühmte Klage der Elemente im "Liber
vitae meritorum" III,1 der Hildegard von Bingen lautet:
"Wir können nicht laufen und unseren Weg demgemäß
vollenden, wie unser Gebieter es uns bestimmt hat. Denn
die Menschen drehen uns mit ihren bösen Werken um wie
eine Mühle. Daher stinken wir vor Pest und vor Hunger
nach der ganzen Gerechtigkeit." (Liber vitae
meritorum/LVM III,1 - übersetzt von Maura Zátonyi) Das
scheint bereits vorweg zu nehmen, was der Humanist
Paulus Niavis Ende des 15. Jahrhunderts in seinem
"Iudicium Iovis" von antiken Gottheiten verhandelt sein
lässt. Bei Paulus Niavis ist der Bergbau im Erzgebirge
Anlass der Klage von "Terra Mater". Und bei Hildegard?
Auf den ersten Blick handelt es sich hier um
Verfehlungen der Menschen allgemeiner Art, um Laster,
Boshaftigkeit, rücksichtslose Lebensführung, Hass, Neid
und so fort, die den Umsturz der Elemente bewirken. Doch
dürfen wir ihre Äußerungen aus dem Mund der Elemente nur
symbolisch lesen? Der Bergbau im Soonwald bei Bingen
erlebte im 11. Jahrhundert einen Aufschwung. Wir müssen
annehmen, dass auch in der Nähe des Klosters Rupertsberg
Kohlemeiler standen, die der weiter folgenden Klage "die
Luft speit so viel Schmutz aus, weil die Menschen ihren
Mund nicht zur Rechtschaffenheit öffnen" (LVM III,2)
insbesondere bei Westwind eine konkrete Grundlage hätten
geben können.
Und der Medizinhistoriker Heinrich
Schipperges deutet dies ganz so, er schreibt vom
"wahrhaft ökologischen Auftrag" des Menschen, der bei
Hildegard zu finden sei, und von seiner (des Menschen)
Schuld "an Luftverschmutzung und Mißernten, an
Krankheiten und klimatischen Katastrophen" (Schipperges
2004, S. 61). Entsprechend übersetzt Schipperges LVM
III,2: "Noch aber sind alle Winde voll vom
Moder, und die Luft speit so viel Schmutz aus, daß die
Menschen kaum noch wagen, ihren Mund aufzumachen"
(Schipperges 2004, S. 60). Im lateinischen Original
steht: "Venti de fetore rauci facti sunt, et
aer sordiditatem euomit, quoniam homines ad rectitudinem
os suum non aperiunt." Es ist erkennbar, wie beide
Übersetzungen über den Befund hinaus interpretierend
verfahren. Wobei Hildegards Erläuterungen (LVM III,26
etwa) eher für die Übersetzung von Zátonyi sprechen -
vielleicht aber auch nur den Konventionen folgen, nicht
dem primären Anliegen der naturkundlich im Kontext der
Zeit vorzüglich gebildeten Autorin.
Unübersehbar ist bei Hildegard von Bingen
der Bezug zur Apokalypse des Johannes. Deren Bilderwelt
ist nach bisherigem Wissensstand aus Naturkatastrophen
und gängigen Katastrophenschilderungen der Zeit
genommen, nicht aus dem Bereich der menschlichen
Naturnutzung. Von Johannes ausgehend und durch die ganze
Geschichte des Christentums hindurch werden
Naturkatastrophen gedeutet als Strafgerichte Gottes für
menschlichen Ungehorsam, für Laster und Sünde. Bei
Hildegard finden wir eine ganz erstaunliche Umdeutung.
Bei ihr greift Gott nicht strafend in das Naturgeschehen
ein - vielmehr erscheinen die Elemente selbst verstrickt
in das Tun der Menschen, vom Menschen aus der Bahn
geworfen: "Die Menschen sind ja mit den Elementen und
die Elemente mit den Menschen verbunden" (LVM III,23).
Hildegardis - eine der ersten Mahnerinnen unseres
Kulturraumes gegen einen nicht-nachhaltigen Naturumgang?
Lesen wir noch, was die Naturforscherin, Theologin und
Psychologin in LVM II die "Maßlosigkeit" sagen lässt:
"Wonach es mich verlangt und was ich suchen kann, das
sammle ich ein und enthalte mich keineswegs. Warum
sollte ich mich enthalten, wenn ich doch keine Belohnung
dafür bekomme? Warum sollte ich aufgeben, was ich bin,
wenn doch jede Gattung nach ihrer Art existiert?" (LVM
II,13). Dem wird von der "discretio"
geantwortet: "Alles nämlich, was Gott eingerichtet
hat, gibt einander Antwort." (LVM II,14) Dies stützt
wiederum die "ökologische" Deutung Schipperges'.
Das
LVM (Liber vitae meritorum) wird zitiert, wo nicht
anders angegeben, nach der Übersetzung von Sr. Maura
Zátonyi OSB.
Lektüreempfehlung: Heinrich Schipperges,
Hildegard von Bingen, München: C. H. Beck, 2004 (5.
Auflage, zuerst 1995)
|
|
Das dritte Reich des
Geistes bei Joachim von Fiore
Joachim von Fiore (~1130/35-1202) war
Sohn eines Notars in Celico/Kalabrien. Nach einer
standesgemäßen Ausbildung arbeitete er selbst einige
Jahre als Notar in Cosenza und dann in der Kanzlei am
Hof von Wilhelm I. in Palermo. Ab etwa 1160
widmete er sich verstärkt religiösen Themen,
pilgerte nach Jerusalem, zog als Prediger durch
die Lande und trat schließlich in ein
Zisterzienserkloster ein. 1191 begründete er
seinen eigenen Orden als strengere Ausgründung der
Zisterzienser, die ihrerseites erst 1098 als Orden
einer strengeren Observanz des Benediktinertums
entstanden waren. Joachim lebte und
wirkte im zeitlichen und konzeptionellen Umfeld
der Blüte des Katharertums, war älterer Zeitgenosse des
Franz von Assisi und des Dominikus von Caleruega.
Er
begann seine religiöse Karriere als apokalyptischer
Wanderprediger, der das unmittelbar bevorstehende
Erscheinen des Antichristen und den Anbruch des
Tausendjährigen Reiches verkündete. Wie auch die anderen
Apokalyptiker seiner Zeit bezog er sich dabei auf das
Johannesevangelium. 1165 hatte er nach eigenem späteren
Bekenntnis bei der Lektüre des Johannesevangelium (Joh.
14,16ff) seine Vision vom Dritten Reich des Geistes, das
nun anbreche, nach dem Reich des Vaters (Hauptanteil
Altes Testament/Ende Neues Testament) und dem Reich des
Sohnes (zu gleichen Teilen Altes und Neues Testament).
Seine um 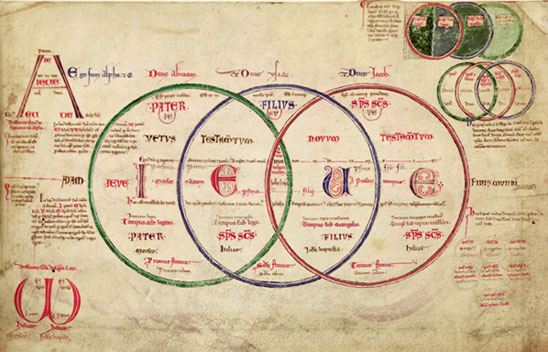 das Jahr
1200 ausgearbeitete Konzeption vom Dritten Reich
(Hauptanteil Neues Testament/Beginn Altes Testament) ist
widersprüchlich und bricht implizite mit den vertrauten
messianischen Konzeptionen, die er selbst zunächst
vermutlich (die Quellenlage zu seinem Leben und Wirken
ist dünn) vertreten hatte, in zweifacher Weise. Zum
einen folgen seine drei Reiche nicht abrupt aufeinander,
sie überschneiden einander vielmehr. Zum zweiten
verdankt sich die Verwirklichung des Dritten Reiches
nicht einer singulären Erlöserfigur (auch wenn Joachim
verschiedentlich den "Engel des siebten Siegels" aus der
Johannesoffenbarung dafür bemüht), Protagonisten sind
vielmehr im Grundsatz alle Menschen, vorrangig gelehrte
Mönche, aber auch Laien, Männer wie Frauen. Joachims
Lehre bedeutete letztlich auch die Abschaffung der Hölle
und des Teufels, die werden bei ihm nicht mehr benötigt. das Jahr
1200 ausgearbeitete Konzeption vom Dritten Reich
(Hauptanteil Neues Testament/Beginn Altes Testament) ist
widersprüchlich und bricht implizite mit den vertrauten
messianischen Konzeptionen, die er selbst zunächst
vermutlich (die Quellenlage zu seinem Leben und Wirken
ist dünn) vertreten hatte, in zweifacher Weise. Zum
einen folgen seine drei Reiche nicht abrupt aufeinander,
sie überschneiden einander vielmehr. Zum zweiten
verdankt sich die Verwirklichung des Dritten Reiches
nicht einer singulären Erlöserfigur (auch wenn Joachim
verschiedentlich den "Engel des siebten Siegels" aus der
Johannesoffenbarung dafür bemüht), Protagonisten sind
vielmehr im Grundsatz alle Menschen, vorrangig gelehrte
Mönche, aber auch Laien, Männer wie Frauen. Joachims
Lehre bedeutete letztlich auch die Abschaffung der Hölle
und des Teufels, die werden bei ihm nicht mehr benötigt.
Wie aber steht es um die Natur, um die menschliche
Leiblichkeit, um Tiere und Pflanzen bei Joachim von
Fiore? Josef Ratzinger hat Joachim in seiner
Habilitationsschrift Schwärmertum vorgeworfen und dessen
Lehre auch noch später in seiner Papstzeit als
"spiritualistisch" und tendenziell "anarchistisch"
kritisiert - etwa in seiner "Generalaudienz" vom 10.
März 2010. Wie der ""neue Himmel" und die "neue Erde"
des Johannes (GO 20,1) aussehen sollten, bleibt unklar
bei Joachim. Bestimmt ist bei ihm lediglich, dass eine
globalisierte Menschheit in unmittelbarem Kontakt mit
dem Göttlichen ein erfülltes diesseitiges Leben führe.
Bestimmt ist auch, dass die zweite Schöpfung kein
Menschenwerk sei, aber der einsichtigen Bejahung durch
die Menschheit bedürfe.
Fiores Einfluss auf die Geistphilosophie Hegels ist
bekannt, blieb allerdings ohne substantielle inhaltliche
Relevanz. Friedrich Engels bezieht sich in seinem Buch
über den Bauernkrieg auf Joachim von Fiore, später Ernst
Bloch in "Das Prinzip Hoffnung". Für den Soziologen
Eugen Rosenstock-Huessy war die russische Revolution
ideologisch durch Joachim von Fiore inspiriert. Die
immer wieder behaupteten Bezüge des Nationalsozialismus
zu Fiores Konzeption vom "Dritten Reich des Geistes" -
angeblich vermittelt durch Arthur Moeller van den Brucks
Buch "Das Dritte Reich" von 1923 - lassen sich nicht
belegen. Moeller erwähnt Joachim von Fiore mit keiner
Silbe, bezieht sich allerdings gelegentlich auf Hegel.
Im übrigen hat der Nationalsozialismus sich entschieden
von Moellers Konzeption einer konservativen Revolution
distanziert (vgl. André Schlüter 2010). Und die
Prophezeiung eines Tausendjährigen Reiches stammt aus
der Johannes-Offenbarung, 20. Kapitel (gelegentlich wird
zur näheren Bestimmung auch auf Joh. 18,36 und andere
Bibelstellen verwiesen, die allerdings keine Zeitdauer
nennen).
Abbildung
aus: Gioacchino da Fiore, Liber Figurarum
|
|
Der Sonnengesang
des Franz von Assisi - "sustentamento" der "creature"
Der Sohn eines wohlhabenden Tuchhändlers in
Assisi, mit bürgerlichem Namen Giovanni Batista
Bernardone (1181/82-1226), beschließt 1205 nach Jahren
jugendlicher Ausschweifungen und zwei gescheiterten
Versuchen, sich als Cavaliere im freiwilligen
Kriegsdienst zu bewähren, sein Leben Gott zu widmen. Seine
Zeit und sein politisch-soziales Umfeld waren
zweifellos religiösen Ausnahmepersönlichkeiten
besonders gewogen. Das 11. und vor allem dann
das 12. Jahrhundert hatten intensive monastische
Reformen erlebt, Zisterzienser, Prämonstratenser und
Augustiner-Chorherren formierten sich im Kontext
bestehender Gemeinschaften. Dazu kamen neue Gründungen
wie die des Bettelordens der Karmeliten um das Jahr
1150, in Südfrankreich breiteten sich die Katharer aus
und die Kreuzzugsideologie des 11. Jahrhunderts war noch
virulent. Ende des 12. Jahrhunderts hatte Joachim von
Fiore seine Vorstellung vom kommenden dritten Reich des
Heiligen Geistes entwickelt, 1215 wurde der Orden der
Dominikaner zur Missionierung der Katharergebiete
gegründet. In Assisi wurde 1193/94 die spätere Heilige
Klara geboren und 1197/98 deren Schwester, die spätere
Heilige Agnes.
Franz von Assisi wird heute gelegentlich als Vorläufer
der Ökologiebewegung gefeiert. In Heft 3/2013 der
Zeitschrift "natur" nennt Franz Alt anlässlich der
Namenswahl des gerade neugewählten Papstes den Heiligen
aus Assisi "Gottes grünen Krieger". "Der Heilige Franz
war konsequenter Ökologe, überzeugter Pazifist, echter
Tierfreund und radikal arm." Schon 1979 hatte Papst
Johannes Paul II. Franziskus zum Schutzheiligen der
Ökologie bestimmt. Das Bild vom "konsequenten Ökologen"
kann sich auf ein einziges Zeugnis, den Sonnengesang des
Franz von Assisi, stützen. Auch bei einer großzügigen
Auslegung der Kategorie "Ökologe" fällt es schwer, der
Auffassung Alts zu folgen. Die menschliche Interaktion
mit der Natur wird im Sonnengesang mit keinem Wort
angesprochen. Dass die Sonne, der Wind und das Feuer als
"Bruder", Mond, Wasser und Erde als "Schwester" -
jeweils dem grammatikalischen Geschlecht im
Italienischen folgend - angesprochen werden, ist
entschieden zu dünn für einen Ausweis eigenständiger
ökologischer Ansätze. Nicht Tiere und Pflanzen werden
hier als Geschwister angesprochen, sondern Sonne, Mond
und die vier Elemente. Damit knüpft Franziskus an antike
Traditionen an, die in der Astrologie und der
Elementenlehre der Renaissance neu belebt wurden. Dass
diese Traditionen zum historischen Erbe des modernen
ökologischen Denkens gehören, sei indes unbestritten.
Franziskus schrieb seinen Gesang "Il Cantico delle
Creature" oder "Cantico di Frate Sole" als er ab 1224
schwerkrank in einem Gebäude der Damianitinnen (später
Klarissen) bei der Kirche San Damiano gepflegt wurde.
Dies erklärt auch die dem Cantico
strukturell fremde letzte Strophe, geschrieben kurz
vor dem Tod, in der die "sora nostra morte corporale",
der leibliche Tod als Schwester, angesprochen wird.
Die im Titel genannten "Creature" sind nicht Objekte,
sondern Subjekte des Cantico. Im ausgeführten Cantico
erscheint dann aber nur der Mensch, noch enger das
sprechende Individuum, subjekthaft. Die anderen
Geschöpfe werden objekthaft mitgenannt, als Geschöpfe
des "Signore", die dieser am Leben erhalte, wobei das
gewählte Wort "sustentamento" durchaus die Qualität
hat, dem Nachhaltigkeitsdiskurs als ein frühes
Dokument zu dienen (das heute gebräuchliche
italienische Wort für "Nachhaltigkeit" ist
"sostenibilità") - es ist allerdings der "signore",
der dieses "sustentamento" leistet, nicht der Mensch.
Später werden "diversi fructi con coloriti flori et
herba" genannt, die "sora nostra matre terra" ("unsere
Schwester Mutter Erde") hervorbringe. Dass der Mensch
irgendeine Verpflichtung diesen gegenüber habe, wird
nicht einmal angedeutet.
Interessant
ist der Sonnengesang als Dokument einer kurzzeitigen
Offenheit des Christentums für naturmystische
Traditionen, wie wir sie auch von Hildegard von Bingen
kennen, die 100 Jahre vor Franz von Assisi gewirkt
hatte. In seiner Allgemeinheit kann der Sonnengesang
jedoch - anders als etwa der mehr als zweitausend Jahre
ältere "Hymnus an die Erde" aus der Atharvaveda - nicht
zur Begründung ökologischer Handlungskonzeptionen
herhalten. Lediglich eine sehr diffuse "Bewahrung der
Schöpfung" lässt sich ableiten. Die hagiographische
Überlieferung (etwa die "Vogelpredigt" aus der Legenda
Maior Sancti Francisci des Bonaventura) behauptet zwar,
dass Franziskus auch ein besonderes Verhältnis zu Tieren
und Pflanzen hegte. Doch nach den bestätigten Zeugnissen
ging es ihm und seinen Mitbrüdern und Mitschwestern
vorrangig um soziale Anliegen, Hilfe für die Armen und
Kranken in der Nachfolge Christi, und um die Lehrarbeit
für ein unmittelbar bevorstehendes Reich Gottes auf
Erden.
|
|
Christianisierung des
Bergbaus
Die auch gegenwärtig noch wirksame Trennung
des Wissenschafts- und Bildungssystems im 19.
Jahrhundert in zwei Bereiche, den der "exakten" und
"wertneutralen" Naturwissenschaften und den der
"wertorientierten" Kultur-/Geisteswissenschaften lässt
uns noch immer etwas ratlos, wenn wir vor
geschichtlichen Zeugnissen stehen, die solche Trennung
nicht kennen oder akzeptieren, die vermengen, was wir
gerne geschieden sähen - sofern nicht politische
und/oder ethische Anliegen eine Zusammenführung
bedingen.
Ein Beispiel für diese "Vermengung" zeigt sich in Leben
und Werk des romantischen Dichters Novalis, der als
Friedrich von Hardenberg auch Bergbauassessor an der
Salinendirektion in Weißenfels war (der sein Vater als
Direktor vorstand). Hardenberg hatte an der zu seiner
Zeit berühmten Bergbau-Akademie in Freiberg/Erzgebirge
studiert, wo kurz nach ihm auch Tulla, der
Rheinbegradiger, einen Teil seiner Ausbildung
absolvierte. Eines seiner bekanntesten Gedichte trägt
den Titel "Maria" und verweist uns über seine
vordergründige Dimension einer romantischen (im
gemeinsprachlichen wie im literaturhistorischen Sinne)
Marienverehrung hinaus auf die heute nur noch wenig
bekannte Begründung des modernen Bergbaus durch die
mittelalterliche Machtentfaltung des Christentums, die
dem Bergbau die Gottesmutter als Schutzpatronin
insbesondere des Silberbergbaus bereit stellte.
Insbesondere in seinem Entwicklungsroman "Heinrich von
Ofterdingen" entfaltet Novalis eine erstaunliche
Verquickung von Bergbau, Religiosität, Liebeskult und
Identitätsbildung. Wie der Bergbau im Umkreis von
Romantik und Deutschem Idealismus die Metaphern für die
Ausbildung des modernen Bürgertums bereitstellte, zeigt
in beispielhafter Weise der Brief Caroline von Schlegels
vom Oktober 1800 an ihren Geliebten und späteren Ehemann
Friedrich Wilhelm Schelling: "Sieh nur Goethen viel und
schließe ihm die Schätze deines Innern auf. Fördre die
herrlichen Erze ans Licht die so spröde sind zu Tage zu
kommen."
Hartmut Böhme hat, im Anschluss an Georg Schreiber, Udo
Krolzik und andere, darauf aufmerksam gemacht, wie lange
vor Novalis, bereits im lateinischen Mönchtum,
insbesondere bei den Benediktinern und weitergeführt
dann bei den Zisterziensern, ineins manuelle Arbeit vom
Makel der Leibeigenentätigkeit befreit und die Nutzung
der Naturressourcen als menschliche Fortsetzung des
Schöpfungsprozesses begriffen wird. In diesem Kontext
kam dem Bergbau eine besonders prägnante Rolle zu, wobei
sich insbesondere Zisterzienserklöster im 12. und 13.
Jahrhundert hervortaten, im Erzgebirge, in der Eifel, im
Harz und andernorts. Nicht nur Pflanzen und Tiere, wie
alttestamentarisch zugesagt, auch die verborgenen
Schätze des Planeten, Grundwasser, Kohle und Erze,
stünden zur Verfügung des Gottesebenbildes, so die
Botschaft der christlichen Klostergründungen im Gefolge
des Heiligen Benedikt. Es ist bemerkenswert, dass
Novalis seine zentrale Figur, Heinrich von Ofterdingen,
dem legendenhaften "Sängerkrieg auf der Wartburg"
entnimmt, der um das Jahr 1200 angesetzt wird, in der
Blütezeit des mittelalterlichen Bergbaus mit seiner
christlichen Begründungsideologie.
Böhme verweist allerdings auch auf eine
charakteristische Ambivalenz in der Konzeption eines
gottgewollten und gottgefälligen Bergbaus. "Der Gedanke
der Mitarbeit an der Vollendung der Natur verbindet sich
eigenartig mit der Auffassung der Natur als Fremde und
Feindin: sie spiegelt in der physischen Abhängigkeit des
Menschen ständig seinen Sündencharakter." (Böhme 1988,
S. 69) Erst der Sündenfall hat es notwendig gemacht,
dass der Mensch der verborgenen Schätze bedürftig ist,
er sich in einer feindseligen Naturumgebung behaupten
muss. In diesem Behauptungskampf stehen ihm Heilige als
Unterstützer zur Seite. Dabei
wurden drei christliche Frauenfiguren zu besonderen
Schutzheiligen des Bergbaus im christlichen Mittelalter,
die heilige Barbara (wegen des Bezugs von Bergbau und
Feuer), die heilige Anna (als Erzmacherin,
Rohstoff-"Mutter") und die Gottesmutter Maria
(insbesondere dem Silberbergbau zugeordnet, als
christliche Wendung der "Terra Mater"). Sie traten an
die Stelle der vorchristlichen Besetzung des Bergbaus
mit keltischen, germanischen, slawischen und römischen
Kulten und Gottheiten im mitteleuropäischen
Bergwesens.
Lektüreempfehlung: Hartmut Böhme, Natur und Subjekt, Frankfurt
(Main) 1988
|
|
Petrarca und die
förderliche Natur
Petrarcas Naturverhältnis ist heute bedeutsam
vor allem durch seine Besteigung des Mont Ventoux (1.912
m) in der Provence, am 26. April 1336, gemeinsam mit
seinem jüngeren Bruder Gherardo und einigen
Bediensteten. Für den Kunsthistoriker Jacob Burckhardt
zeigt sich Petrarca gerade in dieser Bergtour als "einer
der frühsten völlig modernen Menschen" (Burckhardt 2009,
S. 279). Von Alpinisten wird Petrarca gar gerne als
Ahnherr des Bergsteigens gepriesen. Andere feiern den
Mont Ventoux dieser Wanderung wegen als den Geburtsort
des Humanismus, so etwa der holländische Historiker Enne
Koops 2014 auf der angesehenen Online-Plattform
"Historiek".
Petrarca berichtet von seinem epochemachenden Abenteuer
in einem Brief an den älteren Freund Francesco Diogini
vom 26.04.1336, verbunden mit zahlreichen theologischen,
historischen, philosophischen und psychologischen
Reminiszenzen und Reflexionen. Als Begründung für sein
Vorhaben nennt er zu Beginn des Briefes "die Begierde,
die ungewöhnliche Höhe dieses Flecks Erde durch
Augenschein kennenzulernen". Der Berg habe ihn seit
seiner Kindheit begleitet und seit Jahren schon habe ihn
dieses Vorhaben beschäftigt. Natur erscheint in seinem
Bericht als wild und herausfordernd, jedoch keinesfalls
als bedrohlich. Vor den - eher bescheidenen -
Bedrohungen durch spitze Felsen und Dornengestrüpp warnt
lediglich ein "uralter Hirte", doch Petrarca und sein
Bruder ignorieren diese Warnungen und der Briefautor
berichtet dann lediglich von den körperlichen Strapazen,
von seiner Erschöpfung bisweilen, der er sich im Blick
auf das erhoffte Ziel mehr oder weniger murrend
aussetzt.
Darin liegt das eigentliche Novum dieser Erfahrung:
Selbstüberwindung nicht auf der Ebene der Affekte,
sondern körperlicher Erschöpfung gegenüber. Und dies
nicht primär zur moralischen Läuterung (auch wenn
Petrarca seine Erfahrung in dieser Richtung umzudeuten
sucht durch Verweise auf Bibelstellen und auf
Augustinus), sondern mit dem Ziel einer ästhetisch
konnotierten Naturerfahrung. Insofern hat schon Recht,
wer in Petrarca einen Ahnherrn des Bergwanderns sieht.
Aber "Bergwandern" steht dann für etwas anderes, nämlich
die Abkehr von einem Kasteiungsprinzip, das den Körper
zu überwinden, zu bestrafen, gar zu negieren sucht, hin
zu einem Prinzip der Steigerung körperlicher
Leistungsfähigkeit - Ertüchtigung statt Kasteiung, um
Naturgenuss zu ermöglichen.
Petrarcas Leben und Werk sind jedoch nicht nur über die
Besteigung des Mont Ventoux, sondern auf vielfältige
Weise und durchgängig gezeichnet durch eine dezidierte
Zuwendung zur Natur als Rückzugsort, als Trost- und
Erholungsort, als Projektionsfläche für innere
Seelenprozesse, als historischer Vergegenwärtigungsraum
- und nicht zuletzt als Utopie einer vollständigen
Existenz. Es mag irritieren, aber der von Petrarca
skizzierte Humanismus trägt deutlich naturreligiöse Züge
und konfrontiert uns mit einem ersten konsistenten
Entwurf einer zivilisationskritischen Zuwendung
zur Natur. Deutlich wird dies etwa in den Preisungen des
einfachen Lebens "auf dem Lande", mit denen Petrarca
seinen Rückzug an den Quellort der Sorgue zwischen 1337
und 1353 begründet. "De vita solitaria" liest sich
streckenweise wie ein Text der Lebensreformbewegung zu
Anfang des 20. Jahrhunderts. Tongeschirr statt Silber
empfiehlt Petrarca hier, einfache Speisen statt üppiger
Gelage. Und er fordert ein "Leben in der Gegenwart"
statt in steter "Hoffnung auf die Zukunft", die er als
Grundübel ansieht. Daher wende er der Stadt Avignon mit
ihrer Hektik und der besinnungslosen Gier ihrer Eliten
nach Geld, Macht und Luxus den Rücken zu, um sich im Tal
der Sorgue niederzulassen. "Von der Schönheit des
Ortes eingenommen, zog ich mich mit meinen Büchern
dorthin zurück" heißt es in seinem "Brief an die
Nachwelt" von 1370/71. Dahinter stehen unterschiedliche
Traditionslinien und Einflüsse, vor allem der Preis
eines einfachen Lebens in der spätantiken Philosophie
einerseits, die autarke christlich-mönchische
Lebensführung der Reformorden andererseits.
Der weitgehend eigenständige Beitrag Petrarcas liegt
darin, einen neuen Blick auf die Natur mit diesen
Motiven zu verbinden. Und zwar einen durchaus
pragmatischen, der mit dem Sonnengesang des Franz von
Assisi wenig gemeinsam hat. In einem seiner letzten
Zeugnisse aus dem Alterssitz in Arquà am Rande der Colli
Euganei schreibt Petrarca, er habe nun mehr Interesse an
den Kräutern seines Gartens als an seinen Schriften.
Wir müssen Abschied nehmen von der schlichten Annahme
eines Dreischritts in der menschlichen Naturbeziehung,
wonach der Mensch zunächst im Einklang mit der Natur
gelebt habe, sich dann mit dem zivilisatorischen
Fortschritt der Natur entfremdete um sich schließlich in
der Gegenwart wieder über ökologische Konzepte,
Naturethik und Nachhaltigkeitsdiskurs mit der Natur zu
versöhnen - auch in Reaktion auf die Schattenseiten der
Industrialisierung. Der Mythos vom edlen Wilden im
Natureinklang hat schon länger an Kraft verloren, doch
weiterhin sind wir mehrheitlich in fortgeschrittenen
Industriegesellschaften der Überzeugung, die
Industrialisierung sei auch eine Reaktion auf eine als
feindlich erfahrene Natur (Krankheiten, Hungersnöte,
Naturkatastrophen) und ökologisches Denken letztlich ein
Überschußphänomen entwickelter Industriegesellschaften.
Petrarca zeigt uns, dass ein positives Naturverhältnis
bereits an der Wiege des Humanismus steht. Warum es
aufgegeben wurde, können vielleicht die Florentiner
Handels- und Bankenmanager beantworten - ihren
Geschäften war es sicherlich nicht förderlich.
Interessant ist auch Petrarcas Umgang mit den
entsetzlichen Pesterfahrungen 1348 und in den folgenden
Jahren. In "Ad se ipsum" und in Briefen an Freunde
spricht er vordergründig und in der religiösen Rhetorik
der Zeit von einer Strafe Gottes, ohne einen Strafgrund
zu benennen (er fragt gar, weshalb so oft, wenn
Strafgründe vorlägen, von Gott nicht gestraft werde)
oder sich in den üblichen Ermahnungen zu ergehen.
Vielmehr macht er deutlich, dass er die menschliche
Ohnmacht der Pest gegenüber eher auf das Versagen der
scholastischen Medizin und astrologiegläubiger Ärzte als
auf göttlichen Ratschluss zurückführt. Eine "grausame
Natur" als Schuldige gibt es bei Petrarca nicht.
|
|
Das Gericht der Götter
über den Bergbau
Der
böhmische Humanist Paulus Niavis (i.e. Paul Schneevogel
- um 1460-1517) verfasste um 1492/95 in Zittau sein
"Iudicium Iovis", ein auch heute noch lesenswertes
Dokument der kritischen Auseinandersetzung mit der
Ökonomisierung von Natur, konkret mit dem Bergbau. Die
deutsche Übersetzung durch Paul Krenkel, "Das Gericht
der Götter über den Bergbau", macht deutlich, worum es
geht. Publiziert wurde die Übersetzung 1953 durch die
Bergbau-Akademie Freiberg.
In
der Rahmenhandlung wandert ein Eremit durchs Erzgebirge,
seiner Silbervorkommen wegen im 15. Jahrhundert Ort
eines großen "Berggeschreys", das zu
Goldrausch-ähnlichen Verhältnissen führte, mit
erheblichen Schädigungen für Luft, Boden, Wasser,
Menschen, Tiere und Pflanzen. Das beim Silberabbau
eingesetzte Quecksilber vergiftete die Umwelt und die
Bevölkerung der Region auf Generationen hinaus. Der
Mönch nun schaut in einer Vision ("mirabilis visio")
eine erstaunliche Gerichtsverhandlung, die den
"sterblichen Menschen" anklagt wegen seiner Vergehen am
Schneeberg und andernorts durch die Anlage von
Bergwerken, der Tatvorwurf lautet: "Muttermord"
(matricidius).

Vor
dem Thron Jupiters als Richter tritt als Klägerin die
Mutter Erde ("Terra Mater") auf, anwaltlich vertreten
durch Merkur. Zeugen der Anklage sind (in
der Reihenfolge ihres Auftritts) Bacchus, Ceres,
Minerva, Pluton, eine Najade, Charon und eine Gruppe
von Faunen. Bemerkenswert, wie Schneevogel hier
griechische und römische Götter/Göttinnen/Nymphen
neben- und miteinander agieren lässt. Der Unterschied
zwischen griechischer und römischer Antike auch in der
Götterwelt war den Humanisten natürlich bewußt. Worum
es hier geht ist die gemeinsame Frontstellung der
Antike gegen die anbrechende Neuzeit, genauer: gegen
konkrete Missstände in dieser Neuzeit.
"Terra Mater" trägt ein zerfetztes Gewand, ihr Leib
ist "durchbohrt, verwundet und blutüberströmt"
(Niavis 1953, S. 16) - die Leidensgeschichte Christi
klingt unüberhörbar an. Die von Merkur und den anderen
Gottheiten und Geistern vorgetragene Anklage bezieht
sich insbesondere auf das Abpumpen unterirdischer
Wasservorkommen, das Wein- und Ackerbau schädige, die
Umleitung von Gewässern, die Verlärmung der Landschaft
durch die Belüftungspumpen, Waldzerstörung durch
Abholzungen und Köhlerei. "Terra Mater" werde dadurch
im Innersten geschädigt. Eine ähnliche, wenngleich
weniger drastische Kritik am Bergbau finden wir
bereits im "Hymnus an die Erde". Im Ton grundsätzlich
übereinstimmend ist Manis (216-276/77) Auffassung vom
Menschen als Zerstörer der Schöpfung im Dienste der
bösen Gottheit Az.
Die
Verteidigungsrede des Menschen, unterstützt durch die
Penaten (römische
Schutzgeister des Hauswesens),
beklagt die "Mutter Erde" als "Stiefmutter", die dem
Menschen ihre größten Schätze vorenthalten möchte
(Niavis 1953, S. 20). Insbesondere wird vorgebracht,
dass der Bergbau den Handel (durch Münzgeld)
erleichtere, die menschliche Kultur (einschließlich
der Religion) entwickle und Menschen auch in weniger
fruchtbaren Landschaften das Überleben ermögliche.
Mehrmals wird darauf hingewiesen, dass doch Jupiter
den Menschen die Erde zu ihrem Nutzen übergeben habe
und von ihnen erwarte, dass sie sich auf dem ganzen
Planeten ausbreiten. Diese Passagen nehmen erkennbar
Bezug auf die entsprechenen Stellen im 1. Buch Mose
(vgl. Niavis 1953, S. 21). Also lange vor der
Industrialisierung, lange vor der Reformation und auch
noch vor René Descartes und Francis Bacon wird hier
die Grundlage formuliert für jenes Verständnis von
"Macht euch die Erde untertan", das heute als das
moderne, aufgeklärte, technisch-industrielle
Naturverhältnis beschrieben wird.
Jupiter überlässt den Urteilsspruch der Fortuna - als
"Königin der Sterblichen". Fortuna erklärt, dass die
Menschen nicht anders könnten, als sie tun, das sei
ihre Bestimmung. Damit aber würden sie sich selbst
zerstören, wobei sie - "was sehr gut ist" - gar nicht
das Ausmaß der Gefahren erkennen, denen sie sich
aussetzten durch ihr Werk (Niavis 1953, S. 38). Woran
Niavis dabei dachte, ist uns nicht bekannt. Aber
hingewiesen sei nur darauf, dass das im Silberbergbau
massiv eingesetzte hochgiftige Quecksilber im
Mittelalter noch als Heilmittel eingesetzt wurde.
Nebenbei bemerkenswert ist der Hinweis auf andere
Bergbaugebiete im 15. Jahrhundert ("in Sizilien, in
Portugal, in Arabien, in dem zu den Alpen gehörigen
Etschlande, in Böhmen und jetzt auch ... im Gebiet des
Meißner Landes" - S. 16) sowie eine ermahnende
Zitation des Prometheus-Mythos (S. 17). Anders als
seinem Übersetzer war Niavis wohl auch noch bekannt,
dass der Kaukasus ein bedeutendes Erzabbaugebiet der
Antike war.
Abbildung: Annaberger Bergaltar, Hans Hesse, um 1521
Lektüreempfehlung: Paulus Niavis, Iudicium Iovis oder
Das Gericht der Götter über den Bergbau, Berlin:
Akademie-Verlag, 1953
|
|
"Natura naturans" und
menschliches Glück
Baruch Spinoza (1632-1677) leistet mit seiner
Formel "deus sive natura" einen erheblichen Beitrag zur
Kulturgeschichte von Technik und Naturbeherrschung. Mit
der Gleichsetzung "Gott=Natur" liefert er eine
philosophische Begründung für einen rücksichtsvollen
Umgang mit der Natur als Vergegenwärtigung Gottes. So
führt dies etwa Ulrich Grober in "Die Entdeckung der
Nachhaltigkeit" aus (Verlag Antje Kunstmann 2010).
Grober stellt das "Modell Spinoza" neben das "Modell
Descartes". Descartes schränke den Herrschaftsanspruch
des Menschen ("nous rendre comme maistres &
possesseurs de la Nature" - Descartes, Discours de la
méthode, 1902, S. 63 - "Sixiesme Partie") nach Grober
lediglich ein durch das erklärte Ziel seiner
Philosophie, die "conseruation de la santé" (ebd.).
Wobei Descartes dabei erkennbar nur die Gesundheit des
Menschen meint, nicht auch eine "intakte Umwelt", wie
Grober spekuliert (Grober 2010, S. 71). Spinoza dagegen
habe, so Grober, dem Herrschaftsanspruch des Menschen
über die Natur das theologische und philosophische
Fundament entzogen. "Gegenüber Descartes'
Inthronisierung des Menschen als Meister und Besitzer
der Natur beharrt Spinoza darauf, dass der Mensch
ebenfalls Teil der Natur sei." (Grober 2010, S. 73).
Spinozas "deus, seu natura" ist in der Tat als
Gleichsetzung von ihm verstanden, wie die entsprechende
Passage in seiner erst posthum veröffentlichten "Ethik"
mit den Verbformen im Singular klar macht: "Ratio
igitur, seu causa, cur Deus, seu Natura agit, & cur
existit, una, eademque est." (Ethik, Teil IV, Vorwort,
Reclam-Ausgabe 1977, S. 438). Die damit formulierte
pantheistisch-naturalistische Position bedeutet
allerdings keinesfalls blank eine Absage an menschliche
Naturbeherrschungsansprüche, sowenig sie einem Löwen
untersagt, andere Tiere aufzufressen. Sie blockiert
zunächst nicht einmal die Möglichkeit, mit Verweis auf
eine Gottesebenbildlichkeit des Menschen zu operieren.
Denn warum sollte der Mensch nicht in Analogie nun zur
Schöpfungskraft der Natur/Gottes tätig werden? Immerhin
erwartet Spinoza vom Menschen, dass er die Einheit
seines Geistes mit der Natur begreife ("Abhandlung über
die Verbesserung des Verstandes" - Einleitung, Absatz
13) - und damit zum Glück gelange.
Spinoza unterscheidet an der Natur im Anschluss an die
scholastische Tradition im ersten Teil der "Ethica" die
"natura naturans" von der "natura naturata" - beide
zusammen machen Gott/die Natur aus. Die auf Aristoteles
zurückgehende Unterscheidung finden wir in den
Aristoteles-Übersetzungen und Kommentaren von Averroës
und Michael Scottus im 12. Jahrhundert. Die "natura
naturans" wurde in der Scholastik verstanden als
Schöpfergott und scharf getrennt von der "natura
naturata", der Schöpfung mit den Geschöpfen. Spinoza
hebt diese Unterscheidung auf. Damit schafft er ein
System, innerhalb dessen alle menschliche Produktion
letztlich Schöpfung Gottes ist und damit vollkommen.
Realität und Vollkommenheit sind für Spinoza ein und das
selbe, "per realitatem, & perfectionem idem
intelligo" (Ethica Pars II, Definitiones VI). Alle
menschlichen Fähigkeiten sind nichts weiter als Teil der
"natura naturata", explizite gilt dies auch für den
"intellectum" (Ethica Pars I, Propositio XXXI). Auch der
Mensch kann also nicht selbst wahrhaft schöpferisch
werden. Was Menschen zur Realität bringen, bringen sie
zur Realität Gottes.
Daraus ergeben sich für den Naturumgang streng genommen
fatale Konsequenzen. Auch Umweltgifte, CO2-Frachten und
Atommüll gehören zunächst einmal zur Realität Gottes.
Zumindest wenn wir mit Spinoza bei der "Ordine
Geometrico" seiner Ethik bleiben wollen und nicht, gegen
Spinoza, seinen Ansatz konventionell ethisch
funktionalisieren zu einer Verpflichtung gegenüber der
vorgegebenen, ohne menschliche Intervention vorhandenen
göttlichen Natur. Dass Spinoza indes keine Sollensethik,
sondern eine Strebensethik intendierte, haben Manfred
Walther und andere herausgearbeitet. Und alle
menschliche Arbeit habe sich, so Spinoza in der
Einleitung zu seiner "Abhandlung über die Verbesserung
des Verstandes" Absatz 16, der Aufgabe menschlicher
Vervollkommnung unterzuordnen. Diese Vervollkommnung
setzt explizite keine materiellen Anliegen und Ziele.
Auch in seiner Staatslehre formuliert Spinoza solche
nicht, der Zweck des Staatslebens sei "Frieden und
Sicherheit des Lebens" ("Abhandlung vom Staat", Kapitel
5, § 2).
"Je mehr ferner der Geist weiß, desto leichter kann er
sich selbst leiten und sich Regeln setzen. Und je besser
er die Ordnung der Natur erkennt, desto leichter kann er
sich vor unnützen Dingen hüten." So Spinoza im Kapitel
"Die Lehre von der intellectio" seiner "Abhandlung über
die Verbesserung des Verstandes", Absatz 40. Um
Selbsterziehung ging es dem großen Denker, nicht um
Naturbeherrschung im Äußeren - und auch nicht um eine
"Bewahrung der Schöpfung" im heutigen Sinne. Die
Selbsterziehung Spinozas hat im umgangssprachlichen
Sinne sicherlich mit Beherrschung der - inneren - Natur
zu tun, allerdings durch Verstehen und bewusstes
Arbeiten gemäß den Gesetzmäßigkeiten der Natur. Wir
Heutigen können daraus auch einen entsprechenden Umgang
mit der äußeren Natur ableiten, allerdings keineswegs im
Sinne haushälterischer Nachhaltigkeit oder frommer
Rücksichtnahme - denn Spinoza sah den Menschen
keineswegs in der Lage, der "ewigen Ordnung der gesamten
Natur" gefährlich werden zu können oder auch nur
nützlich zu sein (s. "Abhandlung vom Staat" §8).
Aufgeklärt pragmatisch wäre ein aus Spinozas Denken
ableitbarer Naturumgang etwa das, was der ökologische
Landbau praktiziert, Schädlingsbekämpfung durch
Nützlinge und Ähnliches. Seine Reflexionen auf die
Bedingungen menschlicher Schwächen, die immer auch die -
modern gesprochen - Frage nach den Interessen
implizieren, sind darüber hinaus strukturell geeignet,
unseren Naturumgang grundlegend zu erhellen.
Spinoza selbst hat solche Ableitungen nicht unternommen,
er hatte auch wenig Veranlassung dazu, weder aus seinem
Anliegen, noch aus seiner Zeit, die gerade erfolgreich
mit Techne (Windmühlen u.a.) die Niederlande dem Meer
abrang. Obgleich er selbst möglicherweise zum Opfer
einer unkontrollierten Techne wurde: Seine tödlich
verlaufende Lungenerkrankung könnte auf den Schleifstaub
zurückzuführen sein, den er mit seinem Broterwerb als
Linsenschleifer einatmete.
Und doch gibt es in der "Kurzen Abhandlung von Gott, dem
Menschen und dessen Glück" eine Passage, die zeigt, dass
Spinoza sich der problematischen Dimensionen des
menschlichen Naturumgangs durchaus bewußt war. Im 24.
Kapitel, "Von Gottes Liebe zum Menschen" schreibt er "in
Kürze" zu den menschlichen Gesetzen, dass diese
übertreten werden können, da sie nicht notwendig auch
"zum Glück der ganzen Natur" dienten, vielmehr "wohl zur
Vernichtung vieler andrer Dinge" beitragen könnten
(Absatz 5). Und dann nennt er im gleich folgenden Absatz
6 die Bienen und den Imker, der sie "unterhält und
pflegt" als Beispiel für eine gelingende
Austauschbeziehung zwischen Naturdingen und Mensch (den
Spinoza auch als "Ding" bezeichnet in diesem Absatz), in
der beide profitieren.
Zur Kenntnis nehmen müssen wir allerdings auch eine
Passage aus der Ethica, die nicht so zimperlich mit
bestimmten Naturgegebenheiten verfährt: "Ich bestreite
(...) nicht, daß die Tiere Empfindungen haben, ich
bestreite nur, daß es deshalb verboten sein soll, sie zu
unserem Nutzen beliebig zu gebrauchen und sie so zu
behandeln, wie es uns am besten paßt; da sie ja von
Natur nicht mit uns übereinstimmen und ihre Affekte von
den menschlichen Affekten von Natur verschieden sind".
(Ethica IV, Lehrsatz 37, Anmerkung 1) Zu verstehen ist
dies auch als Abgrenzung gegen das Vegetariertum, das
unter verschiedenen religiösen Gruppierungen der Zeit in
den Niederlanden, die 1648 ihre Unabhängigkeit vom
katholischen Spanien gewonnen hatten, verbreitet war.
Spinoza selbst stand den niederländischen Collegianten
nahe, die auch enge Kontakte zu Quäkern hatten, die ab
1655 aus England in die Niederlande kamen. Spinozas
"Kurze Abhandlung" zeigt teilweise große Nähe zum
Gedankengut der Quäker, insbesondere in der Behandlung
des Gleichwertigkeit aller Menschen (Sechstes Kapitel:
Von Gottes Vorherbestimmung, Absatz 7).
Lektüreempfehlung: Michael Hampe/Robert
Schnepf (Hrsg.). Baruch de Spinoza: Ethik in
geometrischer Ordnung dargestellt. Berlin: Akademie
Verlag, 2006
|
|
William Penn - Neue Welt
und Europa
Die frühe Einwanderung aus Europa nach
Nordamerika hatte häufig religiöse Hintergründe, das ist
bekannt. Insbesondere verließen protestantische
Gruppierungen ihre Heimat, weil sie dort verfolgt wurden
oder zumindest nicht die geeigneten Rahmenbedingungen
fanden für ihre Vorstellungen einer konsequent
religiösen Lebensführung. So kamen im 17. Jahrhundert
vor allem aus England auch zahlreiche Quäker nach
Amerika. Sie zeichneten sich aus durch die unbedingte
Überzeugung der Gleichwertigkeit aller Menschen und eine
Haltung der Gewaltfreiheit gegenüber Menschen und Tieren
gleichermaßen. In England wurden sie bis zur
Toleranzakte des englischen Parlaments von 1689 massiv
verfolgt und zu Hunderten ermordet - und noch in den
Jahrzehnten danach waren sie Diskriminierungen durch die
Anglikanische Kirche ausgesetzt.
Willam Penn (1644-1718) war der einflussreichste Quäker
seiner Zeit in England, Sohn eines der reichsten und
mächtigsten Männer des Landes, des Admirals Sir William
Penn sen., der über Landgüter in Irland mit jährlichen
Einkünften im Äquivalent von mehreren hundertausend Euro
verfügte. Penn sen. hatte Oliver Cromwell und das
Parlament unterstützt bei der Rückeroberung Irlands,
aber auch stets gute Kontakte zu den Royalisten
gepflegt. Zum Ritter geschlagen wurde er 1658 von Henry
Cromwell, Sohn von Oliver Cromwell. Sein Sohn William
widmete sich nach einem Studium der protestantischen
Theologie in Paris (wobei ihm ein Empfang bei Ludwig
XIV. gewährt wurde) und einem Jurastudium in London der
familiären Güterverwaltung und schloss sich in den
1660er Jahren der Quäkerbewegung ("Religious Society of
Friends") an. Rasch wurde er zu einem wichtigen Sprecher
und Propagandisten der Bewegung. In den 1670er Jahren
reiste er auch nach Holland und Deutschland (u.a.
Heidelberg), um ein Quäker-Netzwerk innerhalb Europas zu
knüpfen.
Pennsilvania, eine der ersten nordamerikanischen
Kolonien, wurde 1681 von William Penn gegründet in einem
Gebiet, das König Karl II. von England ("Merry Charles")
als Ausgleich für eine Geldschuld bei William Penn sen.
der Familie Penn überließ. Der Koloniegründer schloß
1682 einen nur mündlich überlieferten Friedensvertrag
mit den Delaware-Indianern, die in diesem Gebiet lebten.
Ein Vertrag, der in der Folgezeit idealisiert wurde als
"Great Treaty" und von Voltaire in einem Brief (Vierter
Brief über die Quäker) gepriesen als einziger Vertrag
zwischen Indianern ("ces peuples") und Christen "der nie
geschworen und nie gebrochen" ("qui n'ait point été juré
et qui n'ait point été rompu") worden sei - mythologisch
überhöht zunächst in den Bildern von Edward Hicks, dann
im berühmten Gemälde von Benjamin West 1771/72,
beauftragt von Penns Sohn Thomas.
Es
ist nicht eindeutig geklärt, ob dieser Vertrag nur eine
Art Präambel zu zwei schriftlich überlieferten, am 23.
rsp. 25. Juni 1683 unterzeichneten Verträgen zwischen
Penn und dem Delaware-Häuptling Tamanend über
Delaware-Land darstellte. Als Gegenleistung für die
Landüberlassung vermerkt der Vertrag vom 23. Juni "ye
Consideration of so much Wampum, so many Guns, Shoes,
Stockings, Looking-glasses, Blankets and other goods as
he, ye sd William Penn shall please to give unto me".
Die Friedensgarantie hielt weitgehend bis zur Forderung
der Familie Penn, vertreten durch Penns Sohn Thomas
Penn, an die Delaware, ein Gebiet von 4860
Quadratkilometer Fläche zu räumen, das die Familie als
Besitz reklamierte und Siedlern übergeben wollte, von
Ray Thompson 1973 scharf als "Walking Purchase Hoax of
1737" kritisiert. Im Gefolge kam es im Hinterland
gelegentlich zu Übergriffen auf Siedler, kulminierend im
"Penn's Creek Massacre" von 1755, bei welchem
Delaware-Indianer 24 Siedler töteten. Das Massaker stand
auch im Zusammenhang mit dem Siebenjährigen Krieg
1754-1763, in welchem Frankreich und Großbritannien um
die koloniale Vorherrschaft in Nordamerika kämpften.
William Penn selbst lebte nie für längere Zeit in
Pennsylvania, sondern blieb mit seiner Familie in
England, auf den väterlichen Besitztümern. Er warb
allerdings nachdrücklich, auch in Deutschland, um
Siedler für seine Kolonie. Seinen Aufrufen folgten neben
Quäkern auch Mitglieder anderer protestantischer
Gemeinschaften vor allem aus England und Deutschland.
Bekannt wurden insbesondere die Mährischen Brüder, die
sich allerdings erst nach Penns Tod 1735 in Pennsilvania
ansiedelten und bald erfolgreich unter Indianern
missionierten ("mährische Indianer"). 1782 kam es am
Ende des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges zum
Gnadenhütten-Massaker durch eine Einheit der
Pennsylvania-Miliz an 96 christlichen Indianern (28
Männer, 29 Frauen, 39 Kinder).
In
Auseinandersetzung mit der Expansionspolitik Ludwigs
des XIV. in Schottland und Irland ("Jacobite
Uprising") und im sogenannten Pfälzer Erbfolgekrieg
(Zerstörung des Heidelberger Schlosses 1689 und
Sprengung 1693) schrieb Penn 1693 seinen
republikanisch gesinnten "Essay Towards the Present
and Future Peace of Europe by the Establishment of a
European Parliament". Damit markiert Penn eine Vision
von Europa als Friedensmacht, die dezidiert religiös
fundiert ist, aber auch die naturrechtlichen
Diskussionen der Zeit aufgreift. In den Schriften
Penns finden sich auch bemerkenswerte Passagen zu
einem Frieden mit der Natur, so etwa im Kapitel
"Education" seiner Schrift "Some Fruits of Solitude,
in Reflections and Maxims relating to the Conduct of
Human Life - nebenbei so etwas wie eine erste Skizze
zu Rousseaus "Emile". Unter den Punkten 12 bis 14 ist
dort zu lesen:
12. And it would go a great way to
caution and direct people in their use of the
world, that they were better studied and knowing
in the creation of it.
13.
For how could men find the conscience to abuse it,
while they should see the great Creator look them
in the face, in all and every part thereof?
14.
Therefore ignorance makes them insensible; and to
that insensibility may be ascribed their hard
usage of several parts of this noble creation,
that has the stamp and voice of a DEITY every
where, and in every thing, to the observing.
Und
über den Sinn des Umgangs mit der Natur schreibt Penn
- und wir hören auch hier bereits Rousseausche
Konzepte anklingen - unter "A Country Life":
220. The country life is to be
preferred; for there we see the works of God; but
in cities, little else but the works of men: and
the one makes a better subject for our
contemplation than the other.
Lektüreempfehlung: William Penn, Selected Works, Vol.
II, London 1825, Rep. New York: Kraus Reprint, 1971 -
darin: "Some Fruits of Solitude"
|
|
Schlaraffenland
Im Jahr 1694 veröffentlichte der bedeutendste
deutschsprachige Kartograph der Barockzeit, der Jurist
und Verleger Johann Baptist Homann, die Karte des
"Schlarraffenlandes". Zeitgleich erschien eine
"Erklärung der Wunder-seltzamen Land-Charten UTOPIAE, so
da ist / das neu-entdeckte Schlarraffenland", verfasst
von Johann Andreas Schnebelin. Das gemeinsame Projekt
von Schnebelin und Homann gestaltet die satirische
Verortung menschlicher Laster in einer Topographie des
Schreckens, belegt mit dem bis dato von Thomas Morus bis
Francis Bacon positiv besetzten Begriff der "Utopie".
Wobei allerdings nicht übersehen werden sollte, dass
auch Thomas Morus bereits satirische Elemente in seinen
Roman einschleußt - ob aus eigener kritischer
Überzeugung oder um politischen Gegnern keine
Angriffsfläche zu bieten, bleibt dahingestellt.
Im Vorwort benennt Schnebelin seinen Hauptgegner: den
allgemeinen "Freß- oder Sauff-Discurs" für dessen
Lebensstil "ansehnliche Leute" eine klare Formel haben:
"Es gehet allda zu / wie in dem Schlarraffenland". Und
er bekennt, sein Vorwort abschließend, "daß ich in
Erfindung dieses Wercks einzig und allein dahin gezielet
habe / wie ich denen Lastern spotten / und für
denenselben einem jeden einen Greuel und Eckel
verursachen möge" (Schnebelin 2004, S. 15).
 Zwei
Züge bestimmen den Text. Einmal die Tendenz, den Begriff
"Utopie" dem politisch-gesellschaftlichen Reformdiskurs
zu entziehen. Zum zweiten ein unüberhörbarer
pädagogisch-moralischer Anspruch. Mit der
Begriffsgeschichte von "Utopie" setzt der Autor sich
kenntnisreich gleich im ersten Kapitel, "Von dem Namen
Utopia und Schlarraffenland", auseinander. Er erklärt
offen, dass er den Namen "Utopia" für ein gänzlich
anderes "Concept" verwende als etwa Thomas Morus. Und
mit lindem Spott distanziert er sich auch von einem
Autor, Alberico Gentili, der "Utopia" ähnlich wie er
negativ verwende, dabei allerdings eigene
politisch-religiöse Interessen vertrete, indem er "das
Acumen seines Ingenii an einem oder anderen loco seines
Tractätleins wider die Anfechter seiner Protestantischen
Religion etwas zu viel geschärffet / und den Stachel
seiner Spitzfindigkeit / sonderlich dem geistigen Stand
seiner Widersacher / hat empfinden lassen." Der
moralische Anspruch wird etwa deutlich im Kapitel über
das "Chymische Irrland", wo die Goldmacher am Werke
sind. "Irrland" heiße dieses Land "damit ein jeden zu
verständigen / wie weit die jenigen irr gehen / welche
ihre Gedancken nach einem irdischen Reichthum / so mehr
den Seelen schädlich denn nutzlich ist / eintzig und
allein richten / die / unter dem Schein viel guts zu
würcken / von dem Satan betrogen werden". Damit möchte
der Autor "allen Religionen unpartheyisch" sein - und
wir dürfen ergänzen: auch allen politischen Richtungen,
was in der Barockzeit ohnedies weitgehend
korrespondierte. Seine "Utopia" verhöhne "allein die
Laster (...) welche alle vernünfftige Welt hasset"
(Schnebelin 2004, S. 23). Zwei
Züge bestimmen den Text. Einmal die Tendenz, den Begriff
"Utopie" dem politisch-gesellschaftlichen Reformdiskurs
zu entziehen. Zum zweiten ein unüberhörbarer
pädagogisch-moralischer Anspruch. Mit der
Begriffsgeschichte von "Utopie" setzt der Autor sich
kenntnisreich gleich im ersten Kapitel, "Von dem Namen
Utopia und Schlarraffenland", auseinander. Er erklärt
offen, dass er den Namen "Utopia" für ein gänzlich
anderes "Concept" verwende als etwa Thomas Morus. Und
mit lindem Spott distanziert er sich auch von einem
Autor, Alberico Gentili, der "Utopia" ähnlich wie er
negativ verwende, dabei allerdings eigene
politisch-religiöse Interessen vertrete, indem er "das
Acumen seines Ingenii an einem oder anderen loco seines
Tractätleins wider die Anfechter seiner Protestantischen
Religion etwas zu viel geschärffet / und den Stachel
seiner Spitzfindigkeit / sonderlich dem geistigen Stand
seiner Widersacher / hat empfinden lassen." Der
moralische Anspruch wird etwa deutlich im Kapitel über
das "Chymische Irrland", wo die Goldmacher am Werke
sind. "Irrland" heiße dieses Land "damit ein jeden zu
verständigen / wie weit die jenigen irr gehen / welche
ihre Gedancken nach einem irdischen Reichthum / so mehr
den Seelen schädlich denn nutzlich ist / eintzig und
allein richten / die / unter dem Schein viel guts zu
würcken / von dem Satan betrogen werden". Damit möchte
der Autor "allen Religionen unpartheyisch" sein - und
wir dürfen ergänzen: auch allen politischen Richtungen,
was in der Barockzeit ohnedies weitgehend
korrespondierte. Seine "Utopia" verhöhne "allein die
Laster (...) welche alle vernünfftige Welt hasset"
(Schnebelin 2004, S. 23).
Gegen Ende des 17. Jahrhunderts war der Dreißigjährige
Krieg offenkundig weitgehend vergessen, die Kameralistik
hatte die Schatullen der Fürsten wieder gefüllt, ein
verschwenderischer Lebensstil prägte nicht nur das
höfische Leben, sondern auch wohlhabendes Bürgertum und
Teile der Bauernschaft, die nach dem Bevölkerungsverlust
im Gefolge des Krieges über größere Ländereien als zuvor
verfügen konnten - allerdings auch dem Zugriff der
Fürsten ausgesetzt war. Die Landschaft in Mitteleuropa
war ausgeräumt wie in keiner Epoche zuvor, Wälder,
sofern sie noch existierten, dienten als feudale
Jagdreviere oder Rohstofflieferanten für Bauvorhaben und
Hüttenwesen. Diese Landschaft bot sich geradezu an, mit
einer neuen Topographie gefüllt zu werden. Als Produkt
der barocken Lachkultur war diese Topographie keineswegs
so unpolitisch, wie sie auf den ersten Blick daherkommt.
"Je unpolitischer sich die barocke Satire nach außen hin
gab, desto unverhohlener übte sie Kritik an der
Zivilgesellschaft." So führt Franz Reitinger in seinem
ausführlichen Nachwort zu Schnebelin 2004, S. 281 aus.
Das letzte Reich ist das der Verschwender, die dem
Schlaraffenland seinen Untergang bereiten. Dabei geht es
allerdings nur um die Verschwendung von Geld und Gütern.
Die Verschwendung von Naturressourcen wird nicht
thematisiert. Wenn zu Beginn des Verschwender-Kapitels
von Wald die Rede ist, dann bleiben die Implikationen
unklar: "Von grossen Gehöltzen oder Wäldern ist in
diesen verschwendischen Landen / ausser dem
Weltbekannten Wald / das Kerbholtz genannt / weiters
keines zu ersehen" (Schnebelin 2004, S. 185f). In das
redensartliche Kerbholz werden Schuldenstände
eingekerbt. Andere Wälder gebe es nicht. Das ist zu
wenig, um daraus schon einen Hinweis auf eine Holznot
durch fehlende Ressourcenschonung zu lesen. Es folgt
eine Beschreibung der Nachbarländer, des Jugendlandes,
des Greisenlandes, des unbekannten heiligen Landes und
des höllischen Reiches. Den Abschluss des ganzen Werkes
bildet ein Vanitas-Gedicht mit der Conclusio: "Dein
Hertz im Himmel sey Der alle Lust veracht / Ist der
Gefahren frey." (Schnebelin 2004, S. 225)
Bis ins 20. Jahrhundert hinein blieb es dann bei der
negativen Besetzung der Utopie des Schlaraffenlandes, im
19. Jahrhundert neu geprägt durch Ludwig Bechsteins
Märchensammlung und die Sammlung der Gebrüder Grimm.
Eine Verschiebung in der Bewertung erfolgte erst im
Kontext des "Wirtschaftswunders" der Nachkriegszeit.
1995 erschien eine Sonderausgabe des "Environmental
History Newsletter" mit dem Titel "Der Aufbruch ins
Schlaraffenland. Stellen die Fünfziger Jahre eine
Epochenschwelle im Mensch-Umwelt-Verhältnis dar?" Darin
geht es um die "Entwicklung zur
Verschwendungsgesellschaft". Es ist am Leitfaden der
Beschreibung des "neu-entdeckte(n) Schlarraffenlandes"
anzunehmen, dass auch die Zeit um 1700 eine
"Verschwendungsgesellschaft" kannte, die der Autor
kritisiert.
Abbildung: Pieter
Bruegel der Ältere, Schlaraffenland, 1567
Lektüreempfehlung: Johann Andreas
Schnebelin, Erklärung der Wunder-seltzamen
Land-Charten UTOPIAE, Bad Langensalza: Verlag
Rockstuhl, 2004
|
|
Carl von Carlowitz
und die forstliche Nachhaltigkeit
Einen ersten relevanten Ansatz zum
Nachhaltigkeitskonzept finden wir im Hymnus an die Erde
der Atharvaveda, Entstehungszeit zwischen 1.200 und 800
v. Chr.. Dort heißt es im 35. Vers: "Was ich von dir, o
Erde, ausgrabe, das soll schnell zuheilen. Laß mich, o
Reinigende, nicht deine empfindliche Stelle, nicht dein
Herz durchbohren!" Reduziert auf den sachlichen Kern ist
das hier Vorgetragenen entschieden näher an dem, was wir
heute avanciert unter "starker Nachhaltigkeit"
verstehen, als die Ausführungen des sächsischen
Forstkameralisten Carl von Carlowitz 2500 Jahre später,
in seiner "Sylvicultura oeconomica" von 1713, die ihn
für den Nachhaltigkeitsdiskurs der Medien zum "Erfinder"
der Nachhaltigkeit macht. Carlowitz konnte sich auf
Vorabeiten schon in der sächsischen Forstwirtschaft
sowie in der englischen und französischen Forstökonomie
stützen, die er auf seiner "Cavalierstour" 1665-1669
kennengelernt hatte. Carlowitz sorgte sich dabei nicht
um ökologische oder naturschützende Problemstellungen,
sondern lediglich um den Holzvorrat. Er empfahl gar -
aus heutiger Sicht extrem nicht-nachhaltig - den
Gebrauch von Torf als Grundstoff für die Köhlereien, um
den Nutzungsdruck vom Wald zu nehmen. Und dass die
Bergwerke, denen er vorstand, nicht nur den Wald
bedrohten, sondern Gewässer, Luft und Boden insgesamt,
und damit auch massiv die Gesundheit der ansässigen
Bevölkerung - war nicht sein Thema.
Carlowitz wollte nicht mehr Wald schlagen, als
nachwuchs. Er empfahl eine Forstbewirtschaftung, die auf
gezielte Aufforstung, aber auch auf Naturverjüngung
setzt. Das Anliegen des Oberberghauptmanns
war, "dem allenthalben und insgemein einreissenden
Grossen Holtz-Mangel (...) zu prospiciren" im Interesse
"nothdürfftiger Versorgung des Hauß- Bau- Brau- Berg-
und Schmeltz-Wesens". Was heute nachhaltige
Waldwirtschaft heißt, nannte er dabei "immerwährende
Holtz-Nutzung" oder "nachhaltende Nutzung". Es bleibt
unbestritten, dass nach aktueller Datenlage Carlowitz
zum ersten Mal den Begriff "nachhaltig" (rsp.
"nachhaltend") in einem dem heute dominierenden
ökonomischen Verständnis von Ressourcenschutz
nahestehenden Sinn verwendete. In der Sache hatte er
allerdings zahlreiche Vorgänger in der Forstwirtschaft
der Barockzeit. Peter Poschlod schreibt in seiner
überaus informativen "Geschichte der Kulturlandschaft"
2014, S. 194: "So gilt das 16. Jahrhundert als der
Beginn des Zeitalters der Forstordnungen." Und Poschlod
macht auch deutlich, dass "forestis" ursprünglich dem
Königsrecht zugehörte und die Verfügung über Landschaft
insgesamt, insbesondere die Wald-, Wild- und
Fischnutzung, bedeutete. Was der forstlichen
Nachhaltigkeitsidee einen feudalen Beiton in die Wiege
legt.
Das Putten- und Schäferwesen der Barockkultur sollte
nicht darüber hinwegtäuschen, dass der offenen
Landschaft und den Naturbeständen in dieser Zeit heftig
zugesetzt wurde - insbesondere durch den Bergbau und das
Hüttenwesen, etwa zur Finanzierung ausschweifender
Hofhaltungen, aber auch durch die höfische Jagd.
"Nachhaltigkeit" war in diesem Kontext (der heutigen
Situation durchaus ähnlich) ein Überlebensgebot für die
Eliten, kein Umweltschutzunternehmen im Interesse
bedrohter Tier- und Pflanzenarten. Was Carlowitz
erhalten sollte und wollte, war nur vordergründig der
Wald - es ging im Kern um die sächsischen
Silberbergwerke, deren Fortbestand zum einen durch den
spanischen Silberabbau in Südamerika, insbesondere in
Potosí/Bolivien, zum anderen durch Holzmangel ernsthaft
bedroht war. Wie weit Carlowitz in seiner konkreten
Forstplanung über die ökonomische Notwendigkeit hinaus
ging, ist nicht bekannt. Überliefert sind lediglich aus
seiner "Sylvicultura oeconomica" zwei
ästhetisch-religiös konnotierte Äußerungen, wonach Bäume
mit der "innerlichen Form, Signatur, Constellation des
Himmels" verbunden seien und "die grüne Farbe von denen
Blättern" unsagbar ("ist nicht zu sagen") "angenehm"
sei.
Was heute unter den Prämissen von Klimaerwärmung und
CO2-Einsparung im Blick auf eine nachhaltige Waldnutzung
propagiert wird (kürzere Umtriebszeiten,
kompensatorische Aufforstungen, Durchlichtung,
Forcierung der Brennstoffnutzung) hat weit mehr
Parallelen im Forstmanagement der Sowjetunion unter
Stalin als im spätbarocken Forstwesen unter Carlowitz.
Eine Studie des "KlimaCampus" der Universität Hamburg
von 2010 kommt zum Ergebnis, dass nur eine straffe
Planwirtschaft mit engem Sortenmanagement, kurzen
Umtriebszeiten und regelmäßiger Durchforstung den
deutschen Wald fit machen könne für das Jahr 2100. Das
alternative Modell einer naturprozessnahen
Bewirtschaftung mit langer Lebensdauer der Bäume und
reicher Biodiversität kann vor dem
analytisch-kameralistischen Blick des "KlimaCampus"
nicht bestehen.
Auch wenn es überzogen ist, der Forstwirtschaft die
"Erfindung" der Nachhaltigkeit zuzuschreiben, so kommt
ihr doch sicherlich das Verdienst zu, das
kameralistische Prinzip des "verbrauche nicht mehr, als
du erwirtschaftest" strukturell bedingt erstmals
reflektiert auf ein menschliches Naturverhältnis
übertragen zu haben. Allerdings gibt es bereits aus den
ersten nachchristlichen Jahrhunderten Belege zu
nachhaltiger Waldnutzung im Kontext des Bergbaus, aus
der Region Munigua bei Sevilla (s. "Archäologie
weltweit", Heft 1/2019, S. 30f). Und wer kritischen
Blicks das Gilgamesch-Epos sichtet, kann dort die Klage
finden "wir machten den Wald zur
Einöde" (s.o.).
|
|
Der Blütenpreis des
Barthold Heinrich Brockes: "Den Schöpfer im Geschöpf
zu preisen"
Das bekannteste Gedicht des Barthold Heinrich
Brockes (1680-1747), "Kirsch-Blühte bey der Nacht",
wurde 1727 erstmals veröffentlicht, im zweiten Band der
neunbändigen Sammlung "Irdisches Vergnügen in Gott",
erschienen 1721-1748. Der Sammlungstitel steht für ein
barockes Programm, das in den Naturdingen emblematische
Verweise auf eine transzendente Wirklichkeit sah. Das
Titelblatt konkretisiert den Inhalt als "bestehend in
Physicalisch- und Moralischen Gedichten" - womit neben
dem sittlich-moralischen Anspruch (allegorischer
Naturbegriff) auch ein frühaufklärerisch-naturkundliches
Anliegen (naturwissenschaftlicher Naturbegriff)
formuliert wird.
Barthold Heinrich (auch Bertold Hinrich) Brockes steht
am Übergang von der Barockzeit zur Aufklärung. Der Sohn
eines vermögenden Hamburger Kaufmanns pflegte früh einen
am Adel orientierten Lebensstil, nahm Unterricht in
Tanzen, Fechten, Reiten und in französischer Sprache.
1700-1702 studierte er in Halle (Saale) Jura und
Philosophie. Nach einigen Reisen widmete er sich, zurück
in Hamburg, literarisch-philosophischen Studien und dem
Schreiben. Ab 1720 war Brockes in verschiedenen
politisch-administrativen Ämtern tätig, zunächst als
Ratsherr und Senator Hamburgs, zuletzt als Erster
Landherr von Hamm und Horn. Als Autor hat er einerseits
noch Teil an der "memento mori"- und "Vanitas"-Rhetorik
des Barock und dessen idyllisierender Naturkonzeption,
andererseits an einem analytisch-deskriptiven Blick auf
Naturphänomene, wie er dann das 18. Jahrhundert prägen
sollte.
"Kirsch-Blühte bey der Nacht" wird dominiert von der
"moralischen" Dimension. Die Schönheit und "Weiße" der
Kirschblüte wird überboten von der "Weiße" eines Sterns
und in dieser Linie wird Gott selbst evoziert.
Vorausgegangen ist in der Sammlung der Text "Blühende
Pfirsiche und Aprikosen", es folgt "Noch einige
Betrachtungen der Blühte". Beide Gedichte entfalten am
Beispiel verschiedener Nutzpflanzen eine äußerst
detaillierte phänologische Analyse der Blatt- und
Blütenknospen und ihrer Entwicklung. Auch erste Hinweise
auf den Stoffwechsel der Pflanze werden bereits
formuliert. Der theologisch-moralische Gehalt wird in
der berühmten Wendung "Den Schöpfer im Geschöpf zu
preisen" (in "Noch einige Betrachtungen der Blühte")
angesprochen.
Die drei Texte entfalten in verschiedenen Anläufen ein
Naturbild, das in der Forschung als "pantheistisch"
charakterisiert wird. In unserem Kontext ist vor allem
relevant, dass Brockes hier einen ästhetisch-theologisch
begründeten Eigenwert der Natur konstatiert und dies im
Kontext des menschlichen Nutzens (im Vordergrund stehen
Nutzpflanze, Obstgehölze).
|
|
"Verdi prati, selve
amene, perderete la beltà" - Händels "Alcina" und die
Entzauberung der Natur
Ruggiero, der im Zaubernetz Alcinas gebannte
Held in Georg Friedrich Händels 1735 erstmals
aufgeführter Oper "Alcina", wird durch die Liebe seiner
Partnerin Bradamante frei gemacht von seiner
Verstrickung. Die Versöhnung der beiden Liebenden mündet
am Ende des 2. Aktes in die große Arie "Verdi prati" des
Ruggiero, eine Sarabande.
Verdi prati, selve amene,
perderete la beltà.
Vaghi fior, correnti rivi,
la vaghezza, la bellezza,
presto in voi si cangerà.
Verdi prati, selve amene,
perderete la beltà.
E cangiato il vago oggetto,
all'orror del primo aspetto
tutto in voi ritornerà.
Was hier geschieht, ist eine eigenartige Verkehrung
dessen, was in der höfischen Kultur der Barockzeit für
das Verhältnis Liebe-Natur galt. Liebe war dort
verbunden mit dem "locus amoenus" (vgl. "selve amene"),
dem zauberhaften Platz, einem idyllischen
Paradiesgarten, mit Blumen, Düften, formenreichen
Pflanzengestalten - gebannte, dem Menschen zugerichtete,
inszenierte Wildnis. Und nun kommt ein Liebender, der
gerade befreit wurde aus den Fängen einer amor fou, der
zurückgefunden hat zu seiner Geliebten, und singt nach
der versöhnenden Umarmung: "Ihr grünen Wiesen, ihr
lieblichen Wälder, ihr verliert nun eure Schönheit." Vordergründig
nimmt Ruggiero hier nur Abschied von einer Insel, deren
Naturschönheiten er als Teil eines Gespinstes aus Lug
und Trug durchschaut. Doch Jan Assmann hat schon darauf
hingewiesen, dass diese Arie von äußerster Schlichtheit
sei und zugleich in der von Händel stets in besonders
bedeutsamem Kontext eingesetzten Tonart E-Dur verfasst.
Dies verweist uns auf einen Gehalt, der tiefer geht. Der
"orror del primo aspetto" thematisiert in der Tat mehr
als nur die Aufklärung Ruggieros. Aufgeklärt wird hier
über den im Barock kulturell geleugneten schöpferischen
Eigenwert der Natur, der auch den "orror del primo
aspetto" einer Wüstenei hervorbringen kann.
Hier wird Abschied genommen vom höfischen Naturbild der
Barockzeit, welche parallel zur immensen Naturzerstörung
durch die Jagdleidenschaft der Fürsten und den Aufstieg
des Hüttenwesens kokette Schäferidyllen pflegte und
Natur inszenierte als Schauplatz für Tändelei. Händels
Freund und Kollege Georg Philipp Telemann hatte in
Magdeburg einen ansehnlichen Zierpflanzengarten, den er
auch durch Händel beliefern ließ. "(W)enn man mir die
Wahrheit sagt, so werden Sie die besten Pflanzen von
ganz England erhalten" schrieb dieser aus London in
einem Brief von 1750 an den Freund. Der Garten wird nun
nicht mehr in den Dienst der höfischen Verführung
gestellt, sondern ist Teil bürgerlicher Emanzipation.
Ruggieros Arie steht auch an der Wiege einer neuen
Gartenkultur, die unter anderem den "Englischen Garten"
hervorbrachte. Alcina wurde entmachtet und der "orror
del primo aspetto" der Natur zeigt den Weg zu einer
neuen Form des Naturumgangs, verkürzt zumeist auf die
Formel gebracht "naturwissenschaftlicher Naturbegriff".
Eine ganz andere Deutung erinnert daran, dass die Blumen
und Tiere der Insel, die "verdi pradi" und "selve amene"
ursprünglich Männer waren, die an Alcinas Insel
Schiffbruch erlitten. Der "orror del primo aspetto"
könnte also auch die Männergesellschaft der Seefahrer,
oft Soldaten auf Kriegsfahrt, sein. Bradamante wurde
schließlich auch begleitet von Melisso, der Ruggiero für
einen neuen Kriegszug benötigte! Und natürlich wäre auch
etwas zu sagen zum "Morgenland"-Bild der Zeit, war
Alcina doch eine "morgenländische Zauberin".
|
|
Das Erdbeben von
Lissabon und die unerschütterliche Aufklärung
Am Morgen des 1. November 1755, während der
Gottesdienste zum Fest Allerheiligen, zerstörte ein
Erdbeben der Stärke 9 Lissabon. Viele Einwohner
flüchteten sich zum Hafen, dem größten gebäudefreien
Platz der Stadt. Doch dem Beben folgten Flutwellen von
bis zu 15 Metern Höhe, die über die Mündung des Tejo in
den Hafen und die Stadt eindrangen. Zahlreiche Nachbeben
und eine mehrere Tage andauernde Feuersbrunst brachten
weitere Zerstörungen. Die Feuersbrunst wurde durch
verlassene Herdfeuer und umgestürzte Kerzen in den
festlich erhellten Kirchen ausgelöst. Zwischen 60.000
und 100.000 Einwohner starben in der Katastrophe und 85%
des Gebäudebestandes wurden zerstört. Das Beben war in
weiten Teilen Europas deutlich zu spüren, unter anderem
wurde von ungewöhnlichen Wellen im Hamburger Hafen
berichtet.
Das Erdbeben gilt als Menetekel der Aufklärung,
vergleichbar dem Untergang der Titanic 1912 in seiner
Bedeutung für das Industriezeitalter. Zum 250. Jahrestag
titelte die NZZ: "Lissabon 1755 - das Erdbeben, das die
Welt veränderte". Und Jürgen Wilke fasst in einem
Beitrag für das Online-Magazin EGO vom 18.12.2014 die
allgemeine Einschätzung wie folgt zusammen: "Vielmehr
beeinflusste das Ereignis das europäische Denken
nachhaltig und untergrub den philosophischen Optimismus
der Aufklärung, den Glauben an die göttliche Vorsehung
und die Überzeugung, in der besten aller möglichen
Welten zu leben."
Doch so wenig der Untergang der Titanic über die
Produktion erbaulicher und ermahnender Traktate und
seine Verwendung als technologiekritisches Symbol hinaus
einen relevanten Einfluss auf die gesellschaftliche und
technologische Weiterentwicklung hatte, so wenig konnte
das Erdbeben von Lissabon die Läufe seiner Zeit
entscheidend beeinflussen. Weder wurde die spanische und
portugiesische Kolonisation Mittel- und Südamerikas
gestoppt oder auch nur gemäßigt, noch verlor die
Aufklärung ihren Zukunftsoptimismus. Ganz im Gegenteil
wurde der Wiederaufbau Lissabons zu einem Triumph des
neuen Geistes, das mittelalterliche Lissabon verschwand
und machte einer modernen Metropole Platz. Manager der
Katastrophe war Sebastián José Carvalho e Melo, später
ernannt zum Marques de Pombal, der innerhalb eines
Jahres die Trümmer beseitigen ließ und den Neuaufbau
inszenierte. Im Zuge seiner Tätigkeit wurde er auch zum
Begründer der modernen Seismologie.
Als Argumentationshilfe in den intellektuellen Debatten
der Zeit wurde das Erdbeben allerdings intensiv
eingesetzt. So nutzte Voltaire das Ereignis um gegen die
Konjunktur der Leibnizschen "prästabilierten Harmonie"
anzugehen. Dass er hierzu auch anderes Material zur
Verfügung hatte, nicht auf das Erdbeben angewiesen war,
zeigt sein "Candide" von 1758, in welchem das Erdbeben
zwar vorkommt, aber eine eher untergeordnete Bedeutung
einnimmt im unmittelbaren Kontrast mit den
Leidensgeschichten Kunigundens und "der Alten" - mit
Leiden nicht an zufälligen Naturereignissen, sondern an
menschlicher Bosheit.
|
|
Die Abschaffung
des Unfalls im Deutschen Idealismus
Martina Heßler nennt das umfassende
Vertrauen hochindustrialisierter Gesellschaften in die
technische Lösung aller menschheitlich relevanten
Probleme in ihrer "Kulturgeschichte der Technik" von
2012 im Anschluss an Günther Anders das "Paradigma des
reibungslosen Ablaufs" (S. 188). Zu diesem Paradigma
gehören sowohl die Ausblendung technischer
Versagensmöglichkeiten wie auch die Ausblendung des
Faktors Mensch. Der Faktor Mensch wird dabei nicht nur
in den Unfallursachen, sondern auch in den
Unfallkonsequenzen weitreichend ignoriert. Soziale
Folgekrisen sind nicht ernstlich vorgesehen in den
gängigen Konzepten zur Unfallbewältigung. Hysterien,
Plünderungen oder religiöse, ethnische, soziale
Aufladungen von Krisen im Gefolge technischer
Katastropen werden - entgegen der Faktizität aktueller
Ereignisse - für zunehmend unwahrscheinlicher gehalten,
da sie durch technische und soziale Weiterentwicklung
handhabbar seien (Heßler 2012, S. 180ff).
Einen reibungslosen Ablauf insbesondere im
Naturgeschehen verspricht in den monotheistischen
Religionen die Konzeption des allwissenden,
allmächtigen Gottes. Judentum, Christentum und Islam
haben sich entsprechend abgearbeitet an der Frage nach
der Theodizee, man denke etwa an die Debatten nach dem
Erdbeben von Lissabon 1755. Verweise auf menschliche
Schuld, auf den Sündenfall, auf die Präsenz des Bösen
in der Schöpfung waren insbesondere mit der
christlichen Auffassung eines treu sorgenden,
gnädigen, verzeihenden Gottes schwer vermittelbar.
Papst Benedikt XVI. stellte die Theodizee-Frage am 28.
Mai 2006 bei seinem Besuch des Konzentrationslagers
Auschwitz erneut für die Gegenwart, und er bezog sich
dabei neben Auschwitz auch auf die Katastrophe in
Fukushima.
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling formuliert in
seiner Freiheitsschrift von 1809 - mit Fragezeichen
versehen - die Auffassung, dass die Tätigkeit des
Menschen "selbst mit zum Leben Gottes gehöre".
Naturgeschichte als Entwicklungsgeschichte des Geistes
führe über den Menschen zur Aufhebung der Natur in
Geist, in der bekannten Schellingschen Formulierung
zum Ende seiner Einleitung in die "Ideen zu einer
Philosophie der Natur" von 1797 : "Die Natur soll der
sichtbare Geist, der Geist die unsichtbare Natur sein.
Hier also, in der absoluten Identität des Geistes in
uns und der Natur außer uns, muß sich das Problem, wie
eine Natur außer uns möglich sei, auflösen." In einem
Brief an Eberhard Friedrich von Georgii Ostern 1811
schreibt Schelling von der "Überzeugung einer
wirklichen Einheit Gottes und der Natur", "kraft der
sie (die Natur - H.Sch.) nicht blos als ein
Fehlerhaftes oder Hervorgebrachtes, sondern auf eine
eigentlichere und persönlichere Weise zu ihm (Gott -
H.Sch.) gehört". Diese Überzeugung sei "der wahre
Vollendungspunct menschlicher Wissenschaft". "Natur"
wird dabei nicht sehr präzise bestimmt, von Spinoza
her denkt Schelling sie weitgehend als "natura
naturans", doch im "Hervorgebrachten" steckt natürlich
auch die "natura naturata". Zum Verhältnis der beiden
gibt Schelling einen anfänglichen Aufschluss in einem
Fragment aus dem Nachlass, wo er als "das Ziel aller
Sehnsucht das vollkommen Leibliche als Abglanz des
vollkommen Geistigen" benennt. Die dahinter stehende
Problematik im neuzeitlichen Subjekt-Welt-Verhältnis
ist die von Zufall und Zweckmäßigkeit, wie sie Reiner
Wiehl in seiner Erörterung des Verhältnisses von Kant
zu Spinoza herausarbeitet (Manfred Walter, Spinoza und
der deutsche Idealismus, 1991, S. 15ff).
Wir haben bei Schelling eine erstmals philosophisch
stringent ausgearbeitete Variante der Auffassung von
der Mitwirkung des Menschen am Schöpfungswerk vor uns,
wie sie in den Sintflut-Mythen bereits anklingt und
dann im Christentum entfaltet wird durch die
Mönchsbewegung des Mittelalters. Theoretisch fassbar
wird diese Auffassung zunächst im
Renaissancehumanismus. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz
umreißt in "Die zweite Schöpfung der Welt" 1994 die
Stellung des Menschen für die Renaissance wie folgt:
Er sei "die Vollendung der unvollendeten Schöpfung und
in erster Linie seiner selbst" (S. 51). Gerl-Falkovitz
unterscheidet dabei nicht in die Konzepte
"entwicklungsoffene Fortsetzung der Schöpfung",
"Vollendung der Schöpfung" und "Zweite Schöpfung".
Bei Schelling (wie ähnlich auch bei Hegel) finden wir
einen naturgeschichtlichen Abschlussgedanken
formuliert, der uns heute - nicht zuletzt durch Darwin
und seine Nachfolger belehrt - fremd ist. Doch vor
seinem Hintergrund wird deutlich, auf welch dürftigem
Reflexionsniveau das Vertrauen in technische
Problemlösungen, das letztlich an kulturgeschichtlich
geprägten Abschlusskonzepten wie denen des Deutschen
Idealismus parasitiert, angesiedelt ist.
Lektüreempfehlung:
Martina Heßler, Kulturgeschichte der Technik, Campus
2012
|
|
Träume vom
Friedensreich
Der Quäkerprediger und Kunstmaler
Edward Hicks (1780-1849) gestaltete das Motiv des
"Peaceable Kingdom" - mit Bezug auf das 11. und das 65.
Kapitel des biblischen Buches Jesaja - zwischen 1816 und
1849 wiederholte Male. Erhalten sind 62 Varianten (wobei
die Zuschreibung der ersten Realisierung von 1816/18,
der erst 1822 weitere folgten, umstritten ist). Rechts  im
Vordergrund ist stets Hicks Deutung von Jesaja 11,6-8 zu
sehen, das friedliche Zusammenleben von Raubtieren und
Weidetieren, mit einem oder mehreren Kindern. Dabei ist
der Bezug zu Konflikten innerhalb der
Quäkergemeinschaft/Society of Friends offenkundig. Die
Raubtiere Wolf, Leopard, Bär und Löwe stehen für die
vier Temperamente und für bestimmte Neigungen, die nach
Hicks Auffassung das Zusammenleben der Quäker
beeinträchtigten, insbesondere die Geldgier, die dem
Bären (Phlegmatiker) zugeordnet wird von Hicks, auch in
seinen überlieferten Vorträgen und Schriften.
Geldverleih und Zinsgeschäfte betrachtete Hicks als die
ernsthafteste innere Bedrohung des Quäkertums. Dies
korrespondiert mit der existentiellen Bedeutung, die
diese Bereiche für das Siedlungswesen hatten. Schon die
Gründung Pennsylvanias verdankte sich einem
Kapitalgeschäft der Familie Penn, und die Quäkerbewegung
selbst war eng mit Kapitalgeschäften verbunden, so sind
etwa Barclays, Lloyds und Friends Provident/Friends Life
Quäker-Gründungen. im
Vordergrund ist stets Hicks Deutung von Jesaja 11,6-8 zu
sehen, das friedliche Zusammenleben von Raubtieren und
Weidetieren, mit einem oder mehreren Kindern. Dabei ist
der Bezug zu Konflikten innerhalb der
Quäkergemeinschaft/Society of Friends offenkundig. Die
Raubtiere Wolf, Leopard, Bär und Löwe stehen für die
vier Temperamente und für bestimmte Neigungen, die nach
Hicks Auffassung das Zusammenleben der Quäker
beeinträchtigten, insbesondere die Geldgier, die dem
Bären (Phlegmatiker) zugeordnet wird von Hicks, auch in
seinen überlieferten Vorträgen und Schriften.
Geldverleih und Zinsgeschäfte betrachtete Hicks als die
ernsthafteste innere Bedrohung des Quäkertums. Dies
korrespondiert mit der existentiellen Bedeutung, die
diese Bereiche für das Siedlungswesen hatten. Schon die
Gründung Pennsylvanias verdankte sich einem
Kapitalgeschäft der Familie Penn, und die Quäkerbewegung
selbst war eng mit Kapitalgeschäften verbunden, so sind
etwa Barclays, Lloyds und Friends Provident/Friends Life
Quäker-Gründungen.
Im
Hintergrund zeigt Hicks die Landschaft von
Pennsylvania. Auf fast allen Bildern ist in dieser
Landschaft eine Gruppe von Menschen zu sehen, zumeist
in einer Darstellung des Vertragsabschlusses
zwischen William Penn und den Delaware 1682/83.
1829/30, nach der Spaltung der Quäker in Pennsylvania
1827 in Hickianer (Hicksites - orientiert an Elias
Hicks, Cousin des Malers, mit einer Betonung der
eigenen inneren Christuserfahrung) und Orthodoxen
(Schriftorientierung), malte Hicks einige Bilder mit
einer Gruppe von Quäkern links im Mittelgrund auf dem
bildhaft dargestellten "Weg zum Licht", mit einem
Schriftband, auf welchem zentral "Peace on Earth" zu
lesen ist. Wie
er in seinen "Memoires of the life and religious
labors of Edward Hicks" (publiziert 1851)
ausführt, sah Hicks in William Penns Begründung
von Pennsylvania das "golden age of the best
government under heaven" angebrochen (Hicks 1851,
S. 228).
Für die Quäker waren Indianer gleichberechtigte
Menschen, nicht einem feindlichen Tierreich
näherstehende Wilde, wie für den Großteil der
sonstigen europäischen Siedler. Grundsätzlich
betrachteten die Quäker den "äußeren" Menschen als
integrierten Teil des Tierreiches. Auch was den
"inneren" Menschen, seine Verbindung mit Gott im
"inneren Licht", betrifft, gab es unter den frühen, an
Erfahrung und Empfinden orientierten Quäkern,
verbreitet die Auffassung, dass ihn dies nicht
wesentlich von Tieren unterscheide, dass auch Tiere
mit dem "inneren Licht" begabt seien.
Unterdrückerische Herrschaftsausübung war den frühen
Quäkern grundsätzlich suspekt, dies galt auch für das
Verhältnis Tieren gegenüber. "In general, the Society
opposed oppression, including abuse of animals."
(Weekley 1999, S. 64) Diese Haltung und Auffassung
dürfte den Duktus der Hickschen Bilder vom "Peaceable
Kingdom" mit geprägt haben.
Geboren wurde Edward Hicks im
östlichen Pennsylvania. Seine Eltern waren Mitglieder
der Anglikanischen Kirche. Im Glauben der Quäker wurde
er von seiner Ziehmutter erzogen, nachdem seine Mutter
früh verstorben war. 1803 trat Hicks der
Quäker-Gemeinschaft bei, seinen Lebensunterhalt bestritt
er als Kutschen-Maler und mit sonstiger Schmuck- und
Gebrauchsmalerei. Ab 1812 gab er die Malerei weitgehend
auf und reiste als Prediger im Auftrag der Gemeinschaft
durch das Gebiet von Philadelphia, allerdings führten
ihn finanzielle Probleme bald wieder zurück zur Malerei.
Hicks malte seine Bilder vom "Peaceable Kingdom" zu
einer Zeit, als in den drei Seminolenkriegen (1817-1858)
der letzte organisierte indianische Widerstand brutal
(auch von Militärangehörigen kritisiert) gebrochen wurde
und im "Trail of Tears" 1838 die indianischen Stämme des
nordamerikanischen Südostens umgesiedelt wurden in
unfruchtbare Reservate. Im gleichen Jahr 1838 wurden
auch die Indianer des Nordostens, darunter die Delaware,
umgesiedelt. Während Hicks die Pennsche Utopie in
Bildern propagierte, schrieb Henriette Frölich im fernen
Berlin ihren sozialutopischen Roman "Virginia oder die
Kolonie von Kentucky" (1819). Darin reist die Heldin in
eine Quäkerkolonie. "Ich stimme den meisten ihrer
Grundsätze und Einrichtungen mit inniger Überzeugung
bei, kann aber durchaus nicht begreifen, warum der Geist
der Fröhlichkeit damit unvereinbar sein sollte."
(Frölich 1963, S. 129) Das Thema der Auswanderung nach
Amerika beschäftigt auch Goethes Wilhelm Meister, dem im
Roman allerdings heimatverbunden zugerufen wird "Hier
oder nirgends ist Amerika".
Abbildung: Edward Hicks, Peaceable Kingdom, 1826,
Ausschnitt
Lektüreempfehlung: Carolyn J. Weekley,
The Kingdoms of Edward Hicks. New York: Abrams, 1999
|
|
Der Natur helfen auf
ihrem Weg - die Rheinbegradigung durch Tulla
Johann Gottfried Tullas Vater war
Pfarrer, bei Tullas Geburt 1770 in Nöttingen (heute
Ortsteil von Remchingen), später in Grötzingen, dann in
Britzingen und schließlich in Rüppurr. Der Vater war
offenkundig über seinen Pfarrdienst hinaus interessiert
und engagiert. Er verfasste eine religionspädagogische
Handreichung, eine Geschichte des markgräflichen Hauses
Baden-Durlach sowie eine geographische Datensammlung
Württembergs. Etwa zeitgleich entwickelten
Theologiestudenten am Tübinger Stift den Idealismus
Kants weiter, unter ihnen zwei Jahrgangsgenossen Tullas,
Friedrich Hölderlin und Georg Wilhelm Friedrich Hegel.
Von Tullas Vater war zunächst vorgesehen, dass auch
Johann Gottfried Pastor werde - dessen außergewöhnlichen
Schulleistungen in Mathematik und in den
naturwissenschaftlichen Fächern bahnten dann aber einen
anderen Bildungsweg, sonst hätten wir ihn vielleicht
auch am Tübinger Stift gesehen. Während seiner
Ausbildung verfehlte Tulla dann um eineinhalb Jahre die
Begegnung mit dem Dichter und Philosophen Novalis
(Friedrich von Hardenberg) in Freiberg, wo Tulla im
Wintersemester 1794/95 und im Wintersemester 1795/96
Vorlesungen in Chemie und Mineralogie belegte. Novalis
studierte an der Bergakademie Freiberg ab dem
Wintersemester 1797/98 Bergwesen, Chemie und Mathematik.
63
Jahre nach Voltaires "Il faut cultiver notre jardin" am
Ende seines Schelmenromans "Candide" und 128 Jahre vor
Stalins Großem Plan schreibt Tulla 1822 in seiner
Denkschrift zur Rheinregulierung gleich zu Beginn den
bemerkenswerten Satz "Es ist ein Gesetz der Natur, daß
die Felsen verwittern, die steilen Abhänge sich
verflächen und sanfter werden, die Land-Seen und
Thalgründe ausgefüllt, die horizontalen Ebenen in
abhängige Neigung gebracht und die Erdtheile und
vegetabilischen Theile von den Höhen den tiefern
Gegenden zugeführt und dadurch die Fruchtbarkeit immer
erneuert werde." (Tulla 1822, S. 2) Landschaft als
sanfter Garten, in harmonischer Gestaltung, erscheint so
als eigentliches Ziel des Naturprozesses, das vom
Wasserbauingenieur zu unterstützen sei durch
"Rectificirung", Berichtigung - eine Position, die
theoretisch-philosophisch im Deutschen Idealismus
ausformuliert wurde mit der Aufhebung von Natur in
Geist, insbesondere bei Hegel und Schelling. Tulla
formuliert dieses Prinzip einmal sehr prägnant als "der
Natur nachhelfend, durch Kunst" (Tulla 1822, S. 15).
Allerdings ist der Lobpreis einer gezähmten Natur weit
älter. Das Christentum entwickelte insbesondere im
benediktinischen und später im zisterziensischen
Mönchstum die Vorstellung, der Mensch habe die Schöpfung
weiter zu gestalten durch die Urbarmachung von Wildnis,
konkret auch durch die Nutzung der Wasserkraft. So
schildert die "Descriptio positionis seu sitationis
monasterii Clarae-Vallensis" vom Beginn des 13.
Jahrhunderts die Nutzung der Aube unter gleichsam
bereitwilliger Mitwirkung des Flusses, "er bietet stets
seine Hilfe an und verweigert sie nie. Zuletzt, um
vollen Dank zu ernten und nichts ungetan zu lassen,
trägt er den Abfall fort und lässt alles sauber zurück".
Das oft zitierte Ende von Voltaires
"Candide" gilt als prägnanter Ausdruck für den Rückzug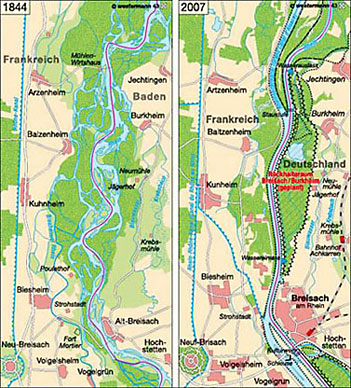 seiner
Helden aus einer
Welt von Gewalt, Egoismus und Niedertracht in die
Überschaubarkeit und Harmonie eines tätigen Daseins im
privaten Bereich. Etwa zeitgleich mit der Abfassung des
"Candide" zog Voltaire selbst sich zurück auf seine
Landgüter bei Genf und widmete sich dort dem Gartenbau und der
Landwirtschaft - schrieb allerdings auch weiterhin
literarische, philosophische und historische Texte,
empfing Besucher aus der ganzen Welt, korrespondierte
und mischte sich unermüdlich politisch ein. Stalins
"Plan zur Umgestaltung der Natur/Plan preobrasowanija
prirody" will die gesamte Landschaft den Prinzipien des
Gartenbaus unterwerfen. Der "Candide" als Dokument eines
schier rousseauistisch (bei aller Feindschaft, die
Voltaire dem leibhaftigen Rousseau und seinen Theorien
entgegenbrachte) anmutenden Rückzugs in den eigenen
Garten, Stalins Großer Plan als Programm der Verwandlung
eines ganzen Landes nach dem Modell des Nutzgartens, mit
gleichmäßigen Parcellen, schützenden Wald-Hecken und
geregelter Bewässerung: Sie haben in Tullas Denkschrift
ihre Bindefuge. seiner
Helden aus einer
Welt von Gewalt, Egoismus und Niedertracht in die
Überschaubarkeit und Harmonie eines tätigen Daseins im
privaten Bereich. Etwa zeitgleich mit der Abfassung des
"Candide" zog Voltaire selbst sich zurück auf seine
Landgüter bei Genf und widmete sich dort dem Gartenbau und der
Landwirtschaft - schrieb allerdings auch weiterhin
literarische, philosophische und historische Texte,
empfing Besucher aus der ganzen Welt, korrespondierte
und mischte sich unermüdlich politisch ein. Stalins
"Plan zur Umgestaltung der Natur/Plan preobrasowanija
prirody" will die gesamte Landschaft den Prinzipien des
Gartenbaus unterwerfen. Der "Candide" als Dokument eines
schier rousseauistisch (bei aller Feindschaft, die
Voltaire dem leibhaftigen Rousseau und seinen Theorien
entgegenbrachte) anmutenden Rückzugs in den eigenen
Garten, Stalins Großer Plan als Programm der Verwandlung
eines ganzen Landes nach dem Modell des Nutzgartens, mit
gleichmäßigen Parcellen, schützenden Wald-Hecken und
geregelter Bewässerung: Sie haben in Tullas Denkschrift
ihre Bindefuge.
Tulla bietet zunächst bemerkenswerte Aussagen zum
Verhältnis Landschaft-Klima, die erhellen, wie intensiv
das 19. Jahrhundert sich mit Klimafragen beschäftigte.
So schreibt er: "Die Gebirge und die Ebenen,
die Waldungen, die Quellen, Bäche, Flüsse, Ströme und
Seen, die Sümpfe und die Steppen, modificiren das Clima,
und es kann dieses in ein und dem selben Land wärmer und
trockener, oder kälter und feuchter werden, nach der
Verschiedenheit der Cultivirung." (Tulla 1822, S. 1)
"Eine zu große Verminderung der Waldungen im Ganzen,
oder auch nur in einzelnen Distrikten, wird und muß
immer nachtheilige Folgen für das Clima und die
Fruchtbarkeit haben." (Tulla 1822, S. 3f) Nicht ganz 50
Jahre später warnt Victor Hehn dagegen: "Man überschätze
auch nicht den Einfluß der Wälder auf das Klima" (Victor
Hehn, "Kulturpflanzen und Hausthiere", 1870, S. 6).
Mit
Nachdruck verweist Tulla auch auf die Funktion von
Überschwemmungen (die sein Begradigungswerk künftig
gerade verhindern sollte) für die Fruchtbarkeit
eines Landes (Tulla 1822, S. 2). Ausführlich
beschreibt er die Funktion der Wälder an Flüssen und
Bächen für den Schutz gegen Erosion und Hochwasser
(Tulla 1822, S. 3) So lesen sich die ersten
Seiten der Tullaschen Denkschrift geradezu wie ein
Plädoyer dafür, den Fluß und seine Auwälder weitgehend
zu erhalten im Bestand. Eingriffe sollten nicht nur die
Schiffbarkeit und die Entwässerung berücksichtigen,
sondern, in heutigen Worten gesprochen, die nachhaltige
Entwicklung einer Region fördern: "Eine planmäßige
Forstkultur und Entwässerungs- und
Bewässerungs-Einrichtung (...) sind die Grundlagen zur
Erhaltung der Fruchtbarkeit eines Landes." (Tulla 1822,
S. 4) Dies wird noch konkretisiert, insbesondere mit
einer klaren Absage an den Privatbesitz von Gewässern
und Ufern. Dann kommt Tulla zum entscheidenden Satz
seiner Denkschrift, der in seinem ersten Teilsatz (zur
umfassenden Kanalisation der Fließgewässer) aus seinen
vorangegangenen Ausführungen keineswegs abzuleiten ist:
"In der Regel sollten in kultivierten Ländern, die
Bäche, Flüsse und Ströme, - Kanäle - seyn, und die
Leitung der Gewässer in der Gewalt der Bewohner stehen"
- wobei er mit "Bewohner" die Öffentlichkeit meint, den
Privatbesitz von Gewässern lehnt er ab (Tulla 1822, S.
7). Insbesondere die Kanalisation und Umleitung von
Bächen und Flüssen zum Betrieb von Maschinen im
Privatbesitz hält Tulla für schädlich (Tulla 1822, S.
6f). Er empfiehlt statt dessen den Einsatz von "Wind,
Feuer und durch thierische Kräfte" (Tulla 1822, S. 6).
Das mutet wie eine frühe Blaupause für Stalins Plan zur
Umgestaltung der Natur an und ist in seiner Bedeutung
nur angemessen zu erfassen vor dem Hintergrund der Zeit.
Napoleons Code civil hatte 1804 das Privateigentum an
Gewässern geregelt - das nach römischem Recht weitgehend
ausgeschlossen war. Frankreich hatte zuvor durchaus in
den Lauf des Rheines eingegriffen, allerdings von ganz
oben. Ludwig XIV ordnete Trockenlegungen zur
Landgewinnung im Elsaß an, die zu massiven
Grenzverschiebungen hinein ins Badische führten.
In
seinen Ausführungen zur Rheinbegradigung selbst erklärt
Tulla dann, dass es Fehler im bisherigen
Flussbettmanagement seien, Fehler im Anlegen der Dämme
(mit der Folge einer Anhebung des Flussbettes und eines
Absinkens des Hinterlandes) sowie im Anlegen von
Siedlungen und Äckern (nämlich zu nahe am Fluss), die
ihn nun zwängen, die Rheinkorrektur brachial
auszuführen: "so bleibt nur ein wirksames Mittel übrig,
die früheren Fehler zu verbessern und die nach und nach
entstandenen Übel zu beseitigen, nemlich die möglichst
gerade Leitung des Flusses, die Abschneidung seiner
Nebenarme, die Demolirung der schädlichen Dämme u.s.w.
also die Rectificirung des Flusses." (Tulla 1822, S.
40). Hier spricht nicht nur der Ingenieur, sondern auch
der Aufklärer Tulla. Und mit Nachdruck kritisiert er die
Missachtung natürlicher Prozesse bei Flusskorrekturen
der Vergangenheit: "Die Nichtbeachtung dieser der Natur
selbst abgewonnenen Maaßregeln, hat immer früher oder
später traurige Folgen für die Uferbewohner" (Tulla
1822, S. 42). Tulla war keineswegs der bornierte
Technokrat, als der er heute bisweilen dargestellt wird.
Und nicht nur die technikbegeisterten Anhänger Tullas,
auch seine naturschützenden Kritiker könnten von ihm
lernen, was ein kooperativer Umgang mit der natürlichen
Umwelt zu beachten hat.
Tulla starb 1828 an den Folgen einer Malariainfektion,
die er sich bei seiner Arbeit am Rhein zugezogen hatte,
in Paris.
Lektüreempfehlung: Johann Gottfried Tulla, Der Rhein
von Basel bis Mannheim mit Begründung der
Nothwendigkeit, diesen Strom zu regulieren. Denkschrift,
Karlsruhe 1822
|
|
"Es
war, als hätt' der Himmel" - eine Poetik des Kahlschlags
Wer kennt es nicht, das
Eichendorff'sche Gedicht von der "Mondnacht", das
beginnt mit den Zeilen "Es war, als hätt' der Himmel/Die
Erde still geküsst". Gemeinsam mit dem Gedicht
"Wünschelrute", das anhebt mit "Schläft ein Lied in
allen Dingen,/Die da träumen fort und fort", gehört es
zum Grundbestand romantischer Lyrik, steht es für eine
Zeit, die noch, so will es das Klischee, im Einklang
stand mit der Natur, ehe die technische
Industrialisierung über Mitteleuropa hereingebrochen
sei.
Von verwunschenen Schlössern und Waldesrauschen schrieb
der Freiherr von Eichendorff, und verwunschen waren die
Schlösser der Ahnen durchaus. Als der Vater 1818 starb,
hinterließ er einen Berg Schulden und teils verwahrloste
Güter. Das seit 1808 anstehende Konkursverfahren war aus
politischen Gründen (Generalmoratorium wegen der
Napoleon-Kriege) ausgesetzt worden bis 1817. Die Mutter
verkaufte einen Teil des familiären Waldbesitzes zur
Abholzung, um die Schulden zu bezahlen. Schloss Lubowitz
aus dem Erbe der Mutter, in welchem Eichendorff geboren
war, blieb der Familie zunächst erhalten. Dazu gehörte
ein Gutsbetrieb mit Getreideanbau und Schafzucht. Die
Kindheit Eichendorffs, das kann nicht genug betont
werden, war geprägt durch ein landwirtschaftliches
Umfeld, die Mutter finanzierte ein Gutteil des
Familienbedarfs vor dem Tod des Vaters aus der Kuh-,
Schweine- und Geflügelhaltung. Eichendorff hatte mit
seinem Bruder Wilhelm noch versucht, diese Idylle seiner
Kindheit zu erhalten. Doch nach dem Tod der Mutter 1822
wurde auch Lubowitz verkauft, eine traumatisierende
Erfahrung für den 36jährigen Dichter. 13 Jahre später
schreibt er die oben zitierten Gedichte.
Es fliegt - wenngleich im Konjunktiv - die Seele "nach
Haus", als der Himmel die Erde küsst - gleichfalls im
Konjunktiv. Zum "hieros gamos", der himmlischen Hochzeit
der Frühzeit, rauschen leis die Wälder. Hegel prägte das
Diktum vom Zerfall des antiken, von Hölderlin
wiederbelebten, "heiligen Haines" in "Holz und Gemüt"
(Erhard Schütz 2017, S. 342). Bei Eichendorff wird dies
sinnhaft im Auseinanderfallen seiner familiär-privaten
ökonomischen Wirklichkeit und seiner literarischen
Produktion. Im Gedicht von 1837, "Der Jäger Abschied"
heißt es "Wer hat dich, du schöner Wald, aufgebaut so
hoch da droben?/Wohl den Meister will ich loben", und im
Kehrreim nehmen die nur im Gedichttitel genannten
"Jäger" wiederholt Abschied mit dem Satz "Lebe wohl/Lebe
wohl, du schöner Wald!", ohne dass wir erfahren, wohin
sie denn ziehen, die Jäger, wir können nur vermuten, in
einen Kampf um Deutschland, denn die letzte Zeile
ersetzt "Lebe wohl, du schöner Wald" durch "Schirm' dich
Gott, du deutscher Wald". Wovor, vor dem Zugriff der
Kapitalakkumulation, vor der Industrialisierung? In
seiner Anfang 1849 entstandenen Satire auf die
revolutionären Ereignisse von 1848, "Libertas und ihre
Freier" wird der industrielle Kapitalismus in der Figur
des zum Baron gewordenen Neureichen "Pinkus" verspottet,
der in einem Schloss mitten im Wald gelegen eine Fabrik
eingerichtet hat. Am Ende kommt die "Libertas" zum
Schloss und erklärt "Ich wollte doch auch wieder einmal
meine Heimat besuchen (...) die schönen Wälder, wo ich
aufgewachsen. Da ist viel abgeholzt seitdem, das wächst
sobald nicht wieder nach auf den kahlen Bergen."
Der Wald und seine Ökonomisierung ist auch Thema einer
neun Jahre nach Eichendorff geborenen und ein Jahr vor
ihm gestorbenen, doch traditionell schon einer anderen
Literaturepoche zugesprochenen Dichterin. Annette von
Droste-Hülshoff schildert in "Die Judenbuche" den
Übergang des Waldes von der Subsistenz ländlicher
Bevölkerung zum Spekulations- und Handelsobjekt - nicht
nur für alte (adelige) und neue (bürgerliche)
Grundbesitzer, sondern auch für professionelle
Waldfrevler. Über die Rolle des Kahlschlags als
Rettungsanker des verarmenden Adels im 19. Jahrhundert
gibt es aus Russland den hervorragenden Tatsachenroman
"Der russische Wald" von Leonid Leonow (russ. 1953, dt.
1960).
Die Benennung "Poetik des Kahlschlags" oder, häufiger,
"Poesie des Kahlschlags" wird in der Germanistik
gelegentlich verwendet für die Literatur nach 1945,
parallel zu "Trümmerliteratur" . Sie geht zurück auf
Statements der Autoren selbst (etwa Alfred Andersch),
die weniger die politischen Ereignisse, als vielmehr die
literarischen Entwicklungen in den Blick nahmen. Ich
verwende den Begriff hier ganz im
forstwirtschaftlich-kameralistischen Sinne.
Erhard Schütz: Romantische
Waldarbeit. In: Lillge, Claudia/Unger, Thorsten/Weyand,
Björn (Hrsg.): Arbeit und Müßiggang in der Romantik,
Wilhelm Fink-Verlag, 2017, S. 329-343
|
|
Alexander von
Humboldt, der erste Naturschützer?
Alexander von Humboldt (1769-1859) wurde zwar
ein halbes Jahr vor Tulla geboren, doch seine Hauptwerke
entstanden erst nach dem Tod Tullas, er gehört
intellektuell bereits einer anderen Generation an, steht
für ein weiter entwickeltes Naturverständnis und eine
Naturbeziehung, die unserem ökologischen Zeitgeist enger
verbunden scheint als die Haltung Tullas. Sein 250.
Geburtstag 2019 brachte ihm daher von der ZEIT-Redaktion
auch das Prädikat "erster Naturschützer" ein, die WELT
titelte "Der erste Öko". Und schon 2015
vertrat die Journalistin Andrea Wulf in ihrer
vielbeachteten Humboldt-Biographie "Alexander von
Humboldt und die Erfindung der Natur" (zuerst auf
Englisch erschienen) die Auffassung, dass Humboldt
die amerikanische Naturschutzbewegung entscheidend
inspiriert habe.
In der Vorrede zu
seinem "Kosmos" bekennt Humboldt 1844 gleich zu
Beginn: "Was mir den Hauptantrieb gewährte, war das
Bestreben, die Erscheinungen der körperlichen Dinge
in ihrem allgemeinen Zusammenhang, die Natur als ein
durch innere Kräfte bewegtes und belebtes Ganzes
aufzufassen." Es ist das Programm, dass wir noch vom
zwanzig Jahre älteren Goethe kennen, nun aber
deutlich untergeordnet dem "Hang nach der Kenntnis
des einzelnen". Hier wird keine Urpflanze mehr
gesucht, sondern die Fülle der Erscheinungen
akribisch erfasst, um in der Natur selbst zu finden,
was Deutscher Idealismus und Romantik im Geist, in
der Moral, in der Phantasie, in der Kunstschöpfung
gesucht und gefunden haben: "Die Natur aber ist das
Reich der Freiheit" ("Einleitende Betrachtungen").
Im V. Kapitel, "Naturbeschreibung.
Naturgefühl nach Verschiedenheit der Zeiten und der
Volksstämme", schreibt der Naturforscher von der
"Verherrlichung der Gottheit aus ihren Werken" (wir
kennen das schon von Spinoza, Brockes und vielen
anderen) im Christentum, was sich in wertschätzenden
Naturbeschreibungen widerspiegele. Wir dürfen hier
auch eine Selbstbeschreibung Alexander von Humboldts
herauslesen, ein Bekenntnis zur eigenen
spinozistisch anmutenden Naturverherrlichung.
Wenn Michael Pilz am 29. Juli 2019 in einem Beitrag
für die "Welt" den Autor des "Kosmos" launig als den
"ersten Öko" charakterisiert, nennt er als
Begründung den künstlerischen Zugriff Humboldts auf
die Natur, die Zeichnungen, sowie sein
ganzheitliches Naturverständnis. "Die Demut, die
sich einstellt, wenn der künstlerische Wert der
Schöpfung auf seinem Papier erscheint, macht
Humboldt zu einem der ersten Ökologen und
Naturschützer." Wie es scheint, kann Pilz sich dabei
auf Humboldt beziehen, der im Kapitel VI über
"Landschaftsmalerei in ihrem Einfluß auf die
Belebung des Naturstudiums" ganz am Ende schreibt:
"Der Begriff eines Naturganzen, das Gefühl der
Einheit und des harmonischen Einklanges im Kosmos
werden um so lebendiger unter den Menschen, als sich
die Mittel vervielfältigen, die Gesamtheit der
Naturerscheinungen zu anschaulichen Bildern zu
gestalten." Eine Auffassung, die in der Gegenwart
mit ihren umfänglichen "Mitteln" zur
Vervielfältigung bedauerlich widerlegt wird.
Humboldt hat in Venezuela die Folgen von Abholzung
und agrarischer Monokultur analysiert und vor
langfristigen negativen Konsequenzen gewarnt. Er ist
allerdings nie in Erscheinung getreten, wo es im 19.
Jahrhundert in seiner Heimat Naturzerstörung und
Umweltvergiftung gab - und die gab es mit der
aufkommenden Verstädterung und Industrialisierung en
masse. Belegt ist, dass er sich immer wieder gegen
Sklavenhalterei ausgesprochen habe, was zumindest
das ihm derzeit gleichfalls gerne angeheftete
Prädikat "Menschenrechtler" begründet. Sicherlich
hat Humboldt wichtige Vorarbeiten für den
Naturschutz geleistet, indem er zur Abhängigkeit der
Vegetation von ihrer Umwelt umfangreiches Material
sicherte und analysierte, Lebensraumtypen wie
"Steppe", "Heide", "Wald", "Wüste" und andere
prägnant charakterisierte. Lange vor Haeckel habe
Humboldt, so der Geograph Ernst Plewe in einem
Vortrag 1969, die Ökologie als Wissenschaft
begründet, "die Erde überhaupt neu sehen gelehrt,
denn das grundsätzliche ökologische Problem ist bei
allen Variationen im einzelnen doch überall
dasselbe" (Plewe 1970, S. 19).
Das Prädikat "Naturschützer" sollte allerdings mit
Fragezeichen versehen werden. Der Zoologe Matthias
Glaubrecht kritisiert in einem Beitrag für den
Tagesspiegel vom 28.12.2016 entschieden die von
Andrea Wulf "seltsam unzeitgemäß" konzipierte
Biografie, für die an Humboldt "alles bio, öko,
global und nachhaltig sowieso" sei.
|
|
Adalbert Stifter und
die Ökologie des Gartenbaus
Die "Vorrede" zu den "Bunten Steinen"
Adalbert Stifters von 1852 beginnt mit dem Verweis auf
eine Kritik Friedrich Hebbels, Stifters Figuren und
Themen seien "unbedeutend". Stifter hält dem seine
Gedanken zum "sanften Gesetz" entgegen, welches seine
Dichtung ebenso bestimme wie es Natur als äußere Natur
und als innere Natur des Menschen bestimme. Maßstab
dieses Gesetzes sei die Erhaltung des Ganzen gegenüber
den Anmaßungen des Individuums - und die Behauptung des
Kleinen und scheinbar Unbedeutenden gegenüber den lauten
Ansprüchen des Gewaltigen. Beispiele hierfür nimmt
Stifter zunächst aus dem Naturbereich. Er setzt das
"Rieseln des Wassers" dem "prächtig einherziehenden
Gewitter" entgegen als das beständig Wirksame gegenüber
dem vorübergehend Zerstörerischen.
Seine Naturbeispiele bereiten uns vor auf die
Ausführungen zur menschlichen Gesellschaft, zur
"sittlichen Geschichte der Menschheit": "Wenn aber
jemand jedes Ding unbedingt an sich reißt, was sein
Wesen braucht, wenn er die Bedingungen des Daseins eines
anderen zerstört, so ergrimmt etwas Höheres in uns, wir
helfen dem Schwachen und Unterdrückten, wir stellen den
Stand wieder her, daß er ein Mensch neben dem andern
bestehe, und seine menschliche Bahn gehen könne, und
wenn wir das getan haben, so fühlen wir uns befriediget,
wir fühlen uns noch viel höher und inniger als wir uns
als Einzelne fühlen, wir fühlen uns als ganze
Menschheit." (Bunte Steine, München: Winkler 1951, S.
10)
Diesem "sanften Gesetz" Stifters hat als einer der
ersten Thomas Mann misstraut: "Hinter der stillen,
innigen Genauigkeit gerade seiner Naturbetrachtung ist
eine Neigung zum Exzessiven, Elementar-Katastrophalen,
Pathologischen wirksam". Eines seiner stillsten und in
der Naturbetrachtung genauesten Werke ist gewiss der
"Nachsommer" (erstmals erschienen 1857). Hier erscheint
als zentrales Bild das Rosenhaus des Freiherrn von
Risach. In der Forschung gilt verbreitet das Urteil, im
Rosenhaus finde sich das Ideal einer Synthese von Natur
und Kultur symbolisch gestaltet. Doch unter dem Titel
"Entfernte Natur: Rosenpracht und Kaktusblüte" verweist
Jochen Berendes in seinen "Studien zum Werk Adalbert
Stifters" von 2009 auf die Brüchigkeit dieser Symbolik
und kommt zum Schluss, es verliere "die vermeintlich
zentrale Rosensymbolik mit der beginnenden
Liebesgeschichte ihre Koinzidenz mit den Handlungen des
Protagonisten". Wie Berendes herausarbeitet, ist die
Erfüllung der Liebesgeschichte begleitet von
verblühenden Rosen; zur Hochzeit wird, mit gärtnerischer
Manipulation und vom Protagonisten Heinrich distanziert
aufgenommen, ein Felsenkaktus (Cereus peruvianus) zum
Blühen gebracht. Die Rosenblüte beginnt erst nach der
Hochzeit und wird - wie auch die Hochzeit selbst - von
Heinrich als Störung charakterisiert. Die Rosenwand im
"Nachsommer" birgt offenkundig die Nähe zum
"Katastrophalen", die Thomas Mann bei Stifter
diagnostiziert. Das wird deutlich in den Ausführungen
Heinrichs zur Bedeutung der Rosenblüte für die
Familienzusammenführung anlässlich der Hochzeit: "Mein
Vater sollte sehen, welche Gewalt die Menge und die
Mannigfaltigkeit auszuüben imstande ist, wenn diese
Menge und Mannigfaltigkeit auch nur lauter Rosen sind."
Dieser "Gewalt" der Rosen und den Störungen durch
Hochzeit und Rosenblüte gegenüber gestellt wird in einer
der bemerkenswertesten Passagen des Werkes - ganz dem
"sanften Gesetz" verpflichtet - die erste Begegnung der
beiden "Väter" des Brautpaares vor der Hochzeit, die
zunächst den Garten Risachs gemeinsam erkunden, dabei
die Rosenwand nur kurz streifen, in einem längeren
Disput jedoch etwas erörtern, das wir heute als
biologischen Pflanzenschutz dem ökologischen Gartenbau
zuordnen würden. Es geht um die Dezimierung von
Schadraupen durch Vögel, wobei Risach keine völlige
Vernichtung der Raupen als erstrebenswert ansieht, um
den Vögeln ihre Nahrungsquelle zu erhalten und auch um
sich an Faltern zu erfreuen. Ein Schaden am Obst durch
die Vögel andererseits wird durch ihren Nutzen
aufgewogen gesehen. Stifter schreibt dies wenige Jahre
vor dem Aufkommen der ersten chemischen
Pflanzenschutzmittel. Und er hatte dem Thema schon zu
Beginn des Buches ein ganzes Kapitel gewidmet, das
fünfte von siebzehn, überschrieben mit "Der Abschied".
"Der Abschied" thematisiert die Vorzüge des Landlebens
gegenüber der städtischen Existenzform und entwirft eine
grandiose Skizze des Gärtnerns, die an Motive Rousseaus
wie Voltaires gleichermaßen erinnert. Und in diesem
Kapitel begegnet Heinrich gleich zu Beginn erstmals auch
dem Kakteenhaus Risachs, der Gärtner führt ihn dorthin,
nicht Risach selbst. Risach erläutert Heinrich dann im
Fortgang des Kapitels die Besonderheit seines
gärtnerischen Ansatzes, der auf einer Zusammenarbeit mit
der Natur basiert. Den dominierenden herrischen Umgang
mit der Natur führt Risach auf "Schwäche und Eitelkeit
des Menschen" zurück. Auf die Nachfrage Heinrichs, warum
Risach denn die Rosenwand seines Hauses an einer Stelle
aufgeführt habe, die von den natürlichen Gegebenheiten
her ganz ungeeignet sei, antwortet Risach mit dem
Verweis auf eine zu bewahrende persönliche Erinnerung.
Und was Risach dann beschreibt, wie er die natürlichen
Gegebenheiten verändert habe, etwa durch Austausch des
Erdreichs oder den gezielten Eingriff in Luftströmungen,
hat ganz erstaunliche Parallelen zum Gartenbau eines
zeitgenössischen Österreichers, der bekannt wurde unter
anderem durch die Pflanzung von Zitrusfrüchten in den
Alpen, Sepp Holzer vom Krameterhof, ein maßgeblicher
Vertreter der "Permakultur", eines Zweiges des
ökologischen Landbaus.
Nach Werner Michler ist Natur "ohne Zweifel einer der
Schlüsselbegriffe in Stifters Werk". In der Forschung
unterscheide man vier verschiedene Naturkonzepte bei
Adalbert Stifter, ein "mythisches", ein "romantisches",
ein "christlich-metaphysisches" und ein
"säkular-empiristisches". Avant la lettre dürfen wir
durchaus auch erste Züge einer im modernen Sinne
"ökologischen" Naturauffassung konstatieren. Im fernen
Jena prägte Ernst Haeckel, wie Stifter vielseitig begabt
und aktiv, bald nach der Veröffentlichung des
"Nachsommers" den Begriff "Ökologie" für die
"Wissenschaft von den Beziehungen des Organismus zur
umgebenden Außenwelt".
Lektüreempfehlung: Werner Michler, Naturkonzepte. In:
Christian Begemann/Davide Giuriato (Hrsg.), Stifter
Handbuch. Leben - Werk - Wirkung, Stuttgart: Metzler,
2017, S.246-249
|
|
Richard Wagners
Alberich und die Sexualisierung der Natur
Die christliche Rechtfertigung des
Bergbaus kippt im 19. Jahrhundert, zügig nach ihrer
Übersteigerung bei Novalis, in eine krude Mischung aus
Neuheidentum, Kapitalismuskritik und Antisemitismus, die
in Wagners Opern ihren populärsten und bildstärksten
Ausdruck fand. Die politisch orientierte Musikkritik
sieht in Alberich, dem bergbauenden Gnom, der das
Rheingold stiehlt, bei Wagner primär ein antisemitisches
Klischee wirksam. Erstmals hat dies Alfred Einstein 1927
formuliert. Ausgearbeitet und einem weiteren Publikum
bekannt wurde die Analyse durch Theodor W. Adorno, in
seiner 1937/38 verfassten Schrift "Versuch über Wagner"
(Kapitel I, "Sozialcharakter"). Und in der Tat gibt es
erhebliche Parallelen zwischen Wagners Charakterisierung
der Nibelungen und seinen Ausführungen zum "Judenthum"
in der Schrift "Das Judenthum in der Musik".
Kulturhistorisch betrachtet schlägt hier die extreme
religiöse Überhöhung des Bergbaus um, wie sie die
Romantik betrieben hatte. Richard Wagner ist Novalis
vielfältig und ambivalent verbunden. Im "Tannhäuser"
greift er den Sängerkrieg auf der Wartburg auf, und zwar
konkret die Legenden um Heinrich von Ofterdingen.
Allerdings verweist die Forschung für den "Tannhäuser"
lediglich auf Bezüge zu "Des Knaben Wunderhorn" (Clemens
Brentano/Achim von Arnim), "Der getreue Eckart und der
Tannenhäuser" (Ludwig Tieck) und "Der Kampf der Sänger"
(E.T.A. Hoffmann), nicht auf den "Heinrich von
Ofterdingen" Novalis'. Dass Wagner indes durchaus
Novalis gelesen hat, zeigen die Bezüge in "Tristan und
Isolde" zu den "Hymnen an die Nacht". Wie aber kommt es,
dass der Bergbau bei ihm wieder von der christlichen
Rechtfertigung abgelöst wird?
Ansätze hierzu finden wir bereits in der Romantik, deren
Verhältnis zum Christentum weit offen ist für dessen
heidnischen Unterstrom. In "Die Bergwerke zu Falun" von
E.T.A. Hoffmann finden wir den Bergbau mit mythischen
Motiven verbunden, mit Geistererscheinungen, Visionen
und einer deutlich sexuell belegten "Bergkönigin".
Wagner selbst setzt mit "Lohengrin" 1850 den
Schlusspunkt seiner affirmierenden Bezüge auf den
christlichen Kanon. Bereits 1848, im Umkreis der von
Wagner unterstützten Revolution in Deutschland, beginnen
die Arbeiten an "Siegfrieds Tod". Den zunächst schwachen
Besuch der Bayreuther Spiele begründete Wagner Nietzsche
gegenüber einem Zeugnis der Schwester Nietzsches zufolge
später so: "Die Deutschen wollen jetzt nichts von
heidnischen Göttern und Helden hören, die wollen was
Christliches sehen." (Kurt Hildebrandt, Wagner und
Nietzsche, 1924, S. 344).
Im Fortgang der Arbeit am Zyklus "Der Ring des
Nibelungen" realisiert Wagner, eng verbunden mit
nationalistischem Ideengut, implizite auch eine
Neubewertung überlieferter Naturbilder, die über die
Wagner eng verbundene Lebensreformbewegung um 1900
wirksam blieb bis ins 20. Jahrhundert hinein.
Das "Heidnische" im Ring ist vorrangig markiert durch
einen Reigen weiblicher Figuren, von den Rheintöchtern
über Freia bis zu Brünnhilde. Die Rheintöchter
partizipieren an der zeitgenössischen Sexualisierung der
Verbindung von Wasser und Weiblichkeit, sind Verwandte
von John Everett Millais' Ophelia und Heinrich Heines
Loreley. Freia und Brünnhilde evozieren chtonische
Muttergottheiten. Sie alle hängen am Ring des Alberich,
entfalten sich vor seiner düsteren Thematisierung von
Erde, Höhle, Bergbau.
Der Biograph Ulrich Drüner weist auch darauf hin, wie
sehr Wagner seine Inspirationen aus alltäglichen
Erfahrungen bezog, die sich ihm bedeutungsvoll aufluden
(Drüner 2016, S. 148f). So hatte Wagner aus der
Landschaft bei Eisenach die Verbindung von Wartburg
(Sängerkrieg) und Hörselberg (Legenden zufolge der
Zugang zur Hölle, "Venusberg") stets vor Augen. Der
Bruder von Wagners verehrtem Stiefvater Ludwig Geyer,
Karl Geyer, war Goldschmied in Eisleben, einer durch den
Kupferbergbau groß gewordenen Stadt. Nach dem Tod seines
Stiefvaters lebte Wagner hier etwa ein Jahr, 1821/1822.
1873 machte er in Eisleben mit Cosima Wagner Station auf
einer Reise durch die Orte seiner Kindheit. In Wagners
"Meistersinger" steht die Tochter eines Goldschmieds,
Eva, im Mittelpunkt des Geschehens.
Lektüreempfehlung:
Ulrich Drüner, Richard Wagner. Die Inszenierung eines
Lebens, Blessing 2016
|
|
Bachofen:
Mutterrecht
Johann Jakob Bachofens Publikation von 1861,
"Mutterrecht", gilt als Entdeckung des Matriarchats, als
erste fundierte Erschütterung der Gewissheit des
patriarchal aufgestellten Bürgertums des 19.
Jahrhunderts, dass Männer eben schon immer "das Sagen
hatten" - wobei das Bürgertum Bachofens Werk zunächst
weitgehend ignorierte. Wirkmächtig gelesen wurde er erst
zwanzig Jahre später von Friedrich Engels, der sich in
"Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des
Staates" emphatisch auf Bachofen bezog und damit eine
breitere Bachofen-Rezeption einleitete. Dass Bachofen
sich dabei nicht auf archäologische, anthropologische,
soziologische und ethnologische Untersuchungen stützte
(nicht stützen konnte, gab es diese doch nur
rudimentär), sondern ausschließlich auf die kulturelle
Überlieferung in historischen Berichten, Mythen,
Legenden und religiösen Schriften, führte in den 1920er
Jahren zu einer zweiten Entdeckung Bachofens, nun im
rechten politischen Spektrum, eingeleitet durch Ludwig
Klages mit seiner Schrift "Vom kosmischen Eros".
Bachofens einseitige Datengrundlage schränkt aus
heutiger Sicht die wissenschaftliche Brauchbarkeit
seiner Herleitungen erheblich ein. Dies ändert jedoch
nichts an der epochalen Bedeutung seiner Schrift.
In seiner "Vorrede und Einleitung" schreibt Bachofen von
"Mutter Erde" und ihrer "wilden Vegetation", die "am
reichsten und üppigsten in dem Sumpfleben den Blicken
des Menschen sich darstellt". Die Verbindung von
Weiblichkeit/Mütterlichkeit und "Sumpfleben" geht zurück
auf die Dämonisierung des Weiblichen und Sexuellen im
Christentum seit Augustinus und sollte im Faschismus
besonders diffamierende Ausprägungen erfahren, wie Klaus
Theweleit in seiner opulenten Untersuchung
"männerphantasien" 1978 herausgearbeitet hat. Bachofen
sieht diese Vorstellung in seinen Quellen repräsentiert
und liest sie als Signum des "Hetärismus", einer frühen
und spezifischen Ausprägung des Matriarchats. Es ist
bemerkenswert, dass Bachofen die seit der Antike
tradierte Verbindung von Frauen- und Naturvorstellungen
noch einmal in extenso referiert und sie zugleich in
Frage stellt mit seinem Nachweis einer historisch
manifestierten Verbindung von Frauen und Kontrollmacht.
Hans G. Kippenberg wählt für seine Ausgabe Bachofenscher
Schriften zu "Mutterrecht und Urreligion" als Motto eine
Passage aus Livius, Ab urbe condita I 56. Dort erfahren
Tarquinus und Brutus vom delphischen Orakel, wer von
ihnen die Macht in Rom erhalten solle. "Ex infimo specu
vocem redditam ferunt: imperium summum Romae habebit qui
vestrum primus, O iuvenes, osculum matri tulerit."
Brutus küsst daraufhin heimlich die Erde, da er davon
ausgeht, das Orakel meine diese Mutter, "scilicet quod
ea communis mater omnium mortalium esset". Das antike,
"heidnische", Bild von "Mutter Erde" wurde dann vom
Christentum massiv zurückgedrängt, lebte allerdings
unterschwellig weiter, wie etwa das "sora
nostra matre terra" im Sonnengesang des Franz von
Assisi zeigt oder die Schrift
"Iudicium Iovis" des böhmischen Humanisten
Paulus Niavis (i.e. Paul Schneevogel), verfasst um
1492/95 in Zittau. Gegen Ende des 18.
Jahrhunderts taucht "Mutter Erde" im Kontext von
Frühindustrialisierung und Aufklärung wieder verwandelt
auf, nun häufig als mütterlich gedachte Natur - so bei
Rousseau und Hölderlin.
Bachofens Arbeit kommt das Verdienst zu, in der
Umbruchsituation des 19. Jahrhunderts mit seinen
bürgerlich-patriarchalen Zugriffen auf die natürliche
Umwelt modellhaft vorgestellt zu haben, wie das
"tellurische" Zeitalter eines "Sumpflebens" in die
"demetrische" Gynaikokratie einer Ackerbaugesellschaft
einmündet, die nicht Ausbeutung, sondern Erhalt der
Fruchtbarkeit im nutzenden Zugriff zum Prinzip hatte.
Vielleicht sollte heute wieder gelesen werden, wie
Bellerophon den Poseidon (das übertretende Meer) auf das
Land Lykien hetzt, dann aber vor den aufgeschürzten
Lykierinnen zurückweicht (Kapitel "Lykien").
|
|
Stalins
Terraforming-Projekte
Um eine differenzierte Darstellung der
Umweltpolitik in der Sowjetunion haben sich die
US-amerikanischen Forscher Douglas Weiner und Stephen
Brain äußerst verdient gemacht. Weiner widmete sich
dabei vor allem der Arbeit der Naturschutzverbände und
den Widerständen, die ihnen von Verwaltungsseite
begegneten, Brain untersuchte die staatliche
Umweltpolitik am prägnanten Beispiel der Forstpolitik.
Forstpolitik und Umweltpolitik waren bereits im
zaristischen Russland weitgehend identisch, insofern der
zaristische Patriotismus den Wald zur Essenz der
russischen Beheimatung erklärte - was nicht verhinderte,
dass unter den Zaren immer wieder ein partieller
Ausverkauf des Waldes stattfand: Für die Entwicklung des
Landes und die Privatinteressen der Regierenden seit
Peter dem Großen (der allerdings auch Aufforstungen und
Waldschutz förderte), für die Schatullen des verarmenden
Adels im 19. Jahrhundert und zur Kapitalakkumulation des
erstarkenden Bürgertums um die Jahrtausendwende.
Vier
praktische Funktionen wurden dem russischen Wald
zugesprochen, und zwar bereits zum Ende des 19.
Jahrhunderts, verstärkt nach den Dürren
mit folgenden Hungersnöten um 1900 und den
katastrophalen Überschwemmungen in Moskau Anfang des 20.
Jahrhunderts: Regulierung des Wasserhaushaltes
für den Boden, Erosionsschutz,
Hochwasserschutz, Klimaverbesserung. Dazu kam die
symbolische Funktion der Identitätsstiftung für die
russische Gesellschaft gegenüber den asiatischen
Nachbarn und dem industriell vorangetriebenen
europäischen Modernismus. Mythen und Märchen,
Volkslieder und Bräuche haben diese Funktion gestützt.
"In the first decades of the twentieth century, forest
specialists devised theories inspired by the idea that
the forest embodied Old Russia, and in the Soviet
period, these concepts did not vanish, but instead
survived, evolved, and in some ways thrived." (Brain
2011, S. 8). Insbesondere die Arbeit von Georgij
Fjodorowitsch Morosow (1866-1920) übersetzte die
patriotische Funktion, aber auch die praktischen
Funktionen in ein Forstkonzept, dessen ausdrückliches
Ziel der Erhalt bzw. die Rekonstruktion jeweils
standorttypischer Wälder war - mit einer entschiedenen
Abkehr vom Kahlschlag mit nachfolgender
Nadelforstpflanzung. Seine Auffassungen verbreitete
Morosow als Professor für Forstwirtschaft in Petersburg
ab 1901 und als Herausgeber des "Lesnoj Schurnal"
1904-1919. Nach seinen Überzeugungen, 1917 vorgetragen
auf der Allrussischen Konferenz der Förster und
Forsttechniker in Petrograd, konnte auch nur der Staat
als Waldbesitzer Garant einer entsprechenden
Forstwirtschaft im allgemeinen gesellschaftlichen
Interesse sein.
"The Russian cultural ecosystem continued to support
ideas about the central role that forests play in
healthy landscapes, regardless of ephemeral political
shifts and even the upheaval of Stalin's Great Break."
(Brain 2011, S. 169) Morosows Ansätze wurden unter
Stalin wesentlicher Bestandteil der Forstpolitik,
insbesondere für die Wälder westlich des Ural. Brain
kommt gar zu folgendem Schluss: "The Soviet
appropriation of Morozov's theories led to the creation
of a unique, distinctly Soviet form of environmentalism,
herein called Stalinist environmentalism." (Brain 2011,
S. 169) Dass auch dieser "environmentalism" verbunden
war mit massenhaften Deportationen, todbringenden
Arbeits- und Straflagern steht außer Frage.
Die Sowjetunion hatte vom Zarismus ein riesiges Reich
übernommen, dessen Landwirtschaft unter anderem - je
nach Region in unterschiedlichem Maße - an Dürren,
Versumpfungen und Bodenerosion litt, die großteils durch
die massiven Abholzungen verursacht oder zumindest
verstärkt wurden. Insbesondere die Dürren
sind ein noch immer bedrohliches Problem der
russischen Landwirtschaft: Im Gebiet Wolgograd
vertrockneten 2007 insgesamt 700.000 Hektar
Sommergetreide, 2010 reduzierte die extreme
Sommerhitze die Landwirtschaftsproduktion um 10%. Befürchtet
wurde im Zarismus wie in der Sowjetzeit auch eine
Ausbreitung der Steppe von Südosten her. Die forcierte
nachholende sowjetische Industrialisierung und
Verstädterung erforderte zudem eine erhebliche
Effizienzsteigerung in der Lebensmittelversorgung. Dazu
kam der auch zur Herrschaftslegitimation den südlichen
Regionen gegenüber formulierte Anspruch, "Wüsten
in blühende Landschaften zu verwandeln" (wusste Helmut
Kohl, wen er zitiert?). Eine wesentliche Rolle bei der
Bewältigung dieser Aufgaben sollte Aufforstung spielen.
Stalins "Plan zur Umgestaltung der Natur" ("Plan
preobrasowanija prirody" - abgeleitet von
"obrasowanie" = "Bildung", "Ausbildung", "Entstehung"),
bekannt auch als "Großer Plan", wird heute vorwiegend
verbunden mit der Umleitung der sibirischen Flüsse Ob
und Jenissej, die ins nördliche Eismeer münden, nach
Süden - mit Anlegung eines
gigantischen Stausees von der siebenfachen Fläche der
Schweiz und Überwindung der Wasserscheide. Dazu gehörte
aber auch ein Projekt westlich des Ural-Gebirges, das
von der Propaganda stärker in den Vordergrund gerückt
wurde und dessen Realisierung wahrscheinlicher schien,
zur Bewässerung und Aufforstung der Südregionen des
russischen Kernlandes. Dieses Projekt - gerne gehandelt
als typisches Beispiel sowjetischer Hybris - wurde in
wesentlichen Elementen bereits 1871 erstmals skizziert,
ausdrücklich zur "Klimaverbesserung in den anliegenden
Ländern" (Jakiw Grigorowitsch Demtschenko, O nawodenii
Aralo-Kaspijskoj nismennosti dlja ulutschenija klimata
prileschaschtschich stran, Kiew 1871), im Zarismus immer
wieder einmal thematisiert und unter Stalin ab 1940 von
Mitrofan Michailowitsch Dawydow als Plan entwickelt,
1950 vom Ministerrat der UdSSR verabschiedet und 1986
unter Gorbatschow offiziell aufgegeben.
Anders als Propagandaplakate der Zeit nahelegen, die vor
allem landwirtschaftliche Flächen in gleichmäßigen
Rechtecken zeigen, stand hinter dem Plan auch ein
gigantisches Aufforstungsprogramm. Sowohl die Flüsse als
auch die landwirtschaftlichen Flächen sollten von
Waldstreifen flankiert sein, gegen Erosion,
Grundwasserabsenkung und Versumpfung. Insgesamt sollten
6 Millionen Hektar Wald neu angelegt werden. Brain nennt
den Großen Plan daher "the world's first explicit
attempt to reverse human-induced climate change" (Brain
2011, S. 140) - nicht ganz klar ist allerdings, wieviel
bestehender Wald Stalins Projekt zum Opfer gefallen
wäre. Zudem hätte die Umsetzung des Planes in weit
massiverer Weise unkalkulierbar in Klimaregulationen
eingegriffen als dies die Waldrodungen der Vergangenheit
taten. Stalins Aufforstungs- und Waldschutzprogramme
wurden allesamt nach seinem Tod weitgehend aufgegeben.
In der Forstwirtschaft setzten sich schon vor Stalins
Tod die Ideen des Agrarökonomen und Lamarckisten Trofim
Denisowitsch Lysenko durch, der Morosows Ansätze als
"romantisch", "bürgerlich" und "anti-sowjetisch"
deklarierte - und der von Stalin im
Landwirtschaftsbereich schon ab 1935 massiv unterstützt
worden war, nicht zuletzt weil seine Theorien
Planerfüllung versprachen und der sowjetischen
Programmatik zur Gestaltung von Mensch und Umwelt ein
wissenschaftliches Fundament zu geben schienen.
Erinnert sei abschließend auch daran, dass Karl der
Große 792/93 den Plan hegte, Rhein und Donau zu einem
Flußsystem zu verbinden, das vom Schwarzen Meer bis zur
Nordsee reichen sollte.
Abbildung: "Stalins Plan zur
Umgestaltung der Natur übertragen wir ins Leben!"
Lektüreempfehlung: Stephen Brain, Song of the Forest.
Russian Forestry and Stalinist Environmentalism
1905-1953, University of Pitsburgh Press 2011
|
|
Land-Art
Gestaltung von Landschaft betreibt die
Menschheit von Anbeginn, prägnant wird sie mit den
ersten in Felsen gehauenen Siedlungen oder Rodungen für
Ackerflächen, ihre späten Stufen kennen wir als
"Geoengineering" - ein Begriff, der erstaunlicherweise
fast nur noch synonym mit "Climate Engineering"
verwendet wird. Dabei ging es um den pragmatischen
Nutzen, nicht um Kunst. Mit der Errichtung von
Kultstätten, Grabhügeln und ähnlichem wird jedoch schon
früh die Grenze zur Kunst tangiert.
Was heute als "Land-Art" bezeichnet wird, entstand in
den 60er Jahren - und sicherlich nicht nur zufällig
zeitgleich mit der Hippie-Bewegung und ihren
Landkommunen, mit dem Aufkommen der Ökologiebewegung und
der Sensibilität für die Interaktion Mensch-Natur. Der
britische Konzeptkünstler Keith Arnatt gräbt sich 1969
in Erde ein und setzt 1970 in Aachen-Monschau virtuell
einen Kackhaufen zur Freiluftausstellung
"Umwelt-Akzente" ab. Wie weit seine Aktionen legitim als
Land-Art bezeichnet werden können, ist so strittig wie
der exakte Begriff von Land-Art. Der einzige erkennbare
gemeinsame Nenner ist, dass der Produktionsprozess
draußen in der - mehr oder weniger - freien
Landschaft/Natur stattfindet und Landschaft/Natur
einbezieht und dass die substantielle Basis des
Produktes draußen verbleibt (in der Regel werden jedoch
Dokumentationen erstellt, die dem Kunstmarkt zugänglich
sind).
Arnatt steht für die Verbindung von Land-Art mit
Konzeptkunst und damit für die Thematisierung der
künstlerischen Subjektivität. Am anderen Pol finden wir
den Briten Andy Goldsworthy, der die Naturmaterialien
und Naturprozesse selbst (auch Sukzession und Verfall)
in den Mittelpunkt seines künstlerischen Interesses
stellt. Für ihn sind Landschaft und Naturmaterialien per
se Kunstwerke, die er ins Bewußtsein heben möchte. Dabei
ist Hintergrundthema immer auch Zeit als entscheidende
Dimension aller Natur-Kunst-Prozesse. Einem breiteren
Publikum bekannt ist seine Arbeit durch den Film
"'Rivers and Tides" von Thomas Riedelsheimer, 2001.
Riedesheimer begleitete die Arbeit Goldworthys in vier
Ländern über alle vier Jahreszeiten.
Einen dritten Ansatz vertritt Christo (Christo
Wladimirow Jawaschew, geboren 1935 in Bulgarien), der
zusammen mit seiner Frau Jeanne-Claude (1935-2009) nicht
nur Gebäude einpackte, sondern auch Teile von
Landschaften und Gewässern besonders markierte durch
Verhüllung. Bei Christo und Jeanne-Claude wird unsere
Art und Weise, Landschaft zu sehen und für das Sehen zu
gestalten, wird Natur als Teil der Kulturgeschichte
thematisch.
|
|
Gaia-Hypothese
In den
60er und 70er Jahren entwickelten die Mikrobiologin Lynn
Margulis und der Biophysiker James Ephraim Lovelock die
Gaia-Hypothese, wonach unser Planet sinnvoll als ein
komplexes, einheitlich sich selbst regulierendes System
verstanden werden könne. Eine Annahme, die inzwischen
weitgehend theoretische Grundlage der Klimaforschung
ist. Den Anfang machte Lovelock, der Ende der 1960er
Jahre aus seinen Arbeiten mit Dian R. Hitchcock (1967)
und C. E. Giffen (1969) zur "atmospheric homeostasis"
(dynamische Konstanz der Gaszusammensetzung in der
Erdatmosphäre mit ca. 21% Sauerstoff) die Auffassung
ableitete, die Erde könne als lebender Organismus
aufgefasst werden. Den Begriff "Gaia" verwendete er
dafür erstmals in einem Beitrag für "Atmospheric
Environment" 6/1972 mit dem Titel "Gaia as Seen Through
the Atmosphere". Im Februar 1975 veröffentlichte
Lovelock gemeinsam mit Sidney Epton in "New Scientist"
den Beitrag "The quest for Gaia", der die Frage stellte,
ob die sichtbaren, erfahrbaren Elemente unseres Planeten
"part of a giant system which could be seen as a single
organism" seien. Rückblickend schrieb Lovelock 1989 in
"Reviews of Geophysics" unter dem Titel "Geophysiology,
the science of Gaia": "To me it was obvious that the
Earth was alive in the sense that it was a
self-organizing and self-regulating system."
Lynn Margulis wurde wissenschaftlich vor allem bedeutsam
durch ihre 1967 erstmals publizierte Hypothese, dass die
nukleinsäurehaltigen Organellen der Zellen ursprünglich
eingewanderte Bakterien gewesen seien. Davon ausgehend
betonte Margulis in ihrer weiteren Arbeit im Kontrast
zur Konkurrenzbetonung im Darwinismus den Aspekt der
Kooperation von Organismen in der Evolution, wobei auch
der Mensch nur Mitspieler einer gewaltigen,
planetenumspannenden intrazellularen Symbiose sei.
Anfang der 70er Jahre traf sie sich auf Empfehlung von
Freunden mit Lovelock. 1974 veröffentlichten Margulis
und Lovelock gemeinsam die Beiträge "Biological
Modulation of the Earth's Atmosphere" in "Icarus"
21/1974 (eingereicht August 1973) und "Atmospheric
Homeostasis by and for the Biosphere: The Gaia
Hypothesis" in "Tellus" 26/1974, in denen sie die
Gaia-Hypothese ausformulierten.
Anfang
der 80er Jahre entwickelte Lovelock mit Andrew Watson
das Daisyworld-Modell, die Computersimulation eines
fiktiven Planeten mit schlichter Biosphäre aus zwei
Gänseblümchen-Arten (weiße und schwarze), die von der
Temperatur auf ihrem Planeten abhängig sind und diese
zugleich stabilisieren, veröffentlicht in "Tellus"
4/1983 unter dem Titel "Biological homeostasis of the
global environment: the parable of Daisyworld".
Anliegen war auch, die Gaia-Hypothese plausibel zu
machen. 1995 veröffentlichte
Lovelock mit dem Geophysiker und Klimaforscher Lee R.
Kump den Beitrag "The Geophysiology of Climate" in
"Future Climates of the World", basierend auf
Einsichten aus dem Daisyworld-Modell.
1995
erschien auch der Essay "Gaia is a Tough Bitch" von
Margulis im spektakulären Sammelband "The Third
Culture", den der Journalist John Brockman
veröffentlichte (dt. 1996, "Die dritte Kultur. Das
Weltbild der modernen Naturwissenschaft"). Darin macht
sie klar, dass "Gaia" den Menschen nicht zu ihrem Erhalt
benötige. "Gaia ist ein zähes Weibsstück ("a tough
bitch") - ein System, das über drei Milliarden Jahre
lang ohne Menschen funktioniert hat. Die Oberfläche
unseres Planeten, seine Atmosphäre und seine Umwelt
werden auch dann noch weiter die Evolution durchlaufen,
wenn Menschen und Vorurteile längst verschwunden sind."
(Brockman 1996, S. 194)
Margulis
distanziert sich in diesem Essay auch deutlich von
Lovelocks personalisierender Gaia-Konzeption: "In
Lovelocks Augen ist die ganze Welt ein Lebewesen. Ich
bin mit dieser Formulierung nicht einverstanden. Kein
Lebewesen frißt seine eigenen Abfälle. Ich bezeichne
die Erde lieber als großes, zusammenhängendes
Ökosystem, das aus vielen kleineren Ökosystemen
zusammengesetzt ist. Lovelock möchte die Menschen
glauben machen, die Erde sei ein Lebewesen, denn wenn
sie darin nur einen Haufen Steine sehen, dann treten
sie mit den Füßen darauf, mißachten und mißhandeln
sie. Wer die Erde als Organismus sieht, wird sie in
der Regel mit mehr Respekt behandeln. Für mich ist es
eine hilfreiche Umschreibung, keine Wissenschaft.
Dennoch bin ich mit Lovelock der Ansicht, daß das
meiste, was Wissenschaftler tun, auch keine
Wissenschaft ist. Außerdem ist mir völlig klar, daß er
mit seinem Standpunkt die Idee von Gaia weit wirksamer
vermitteln kann als ich." (Brockman 1996, S. 194)
In
einem Beitrag der New York Times vom 14. Januar 1996,
"Attack of the Microbiologists", wird Margulis wie
folgt zitiert: "People think the earth is going to die
and they have to save it. That's ridiculous. (...)
There's no doubt that Gaia can compensate for our
output of greenhouse gases, but the environment that's
left will not be happy for any people." Lovelock
vertrat lange auch diese Auffassung und warnte mit katastrophischen
Bildern vor der Erderwärmung durch menschliches Handeln.
2012 korrigiert er seine Prognosen zur Erderwärmung. Er
vertritt nunmehr die Auffassung, Gaia werde dafür
sorgen, dass die Überlebensbedingungen für den Menschen
erhalten bleiben. Ganz unverblümt vertritt er in "A
Rough Ride to the Future" 2014 die tradierte
christlich-jüdische Konzeption der Auserwähltheit des
Menschen als Krönung der Schöpfung. Als Motto seines
Buches wählt er einen Satz von Daniel Dennett, wonach
der Mensch das Nervensystem des Planeten sei. Im Innern
des Buches propagiert er die Atomenergie als Lösung der
Erderwärmungs-Problematik.
Der Mediziner, Physiker und Psychophysiker Gustav
Theodor Fechner hatte bereits 100 Jahre vor Lovelock und
weit differenzierter als dieser die Frage gestellt, "ob
nicht die ganze Welt über den Menschen hinaus ein
psychophysisches System ist, auf welches die am
menschlichen System bewährten Gesetze Anwendung finden"
könnten (Kuntze 1892, S. 305). Und nochmal 50 Jahre
zurück hatten Kant, Fichte, Hegel und Schelling sich mit
Selbstorganisation im Bereich des Organischen oder gar
im gesamten Naturprozess intensivst beschäftigt - teils
in harscher Abgrenzung zu vorangegangen naturmythischen
Spekulationen, teilweise im Bemühen, deren Gehalt
aufgeklärt zu bewahren. Von all diesen Ansätzen
unterscheidet sich der von Lovelock und Margulis
gemeinsam formulierte substantiell durch die
entschiedene Abkehr von einer anthropozentrischen
Perspektive. Die Lovelock allerdings später wieder
einnahm.
Bruno Latour hat im Kontext der
Klimaschutz-Debatte und -Praxis das Gaia-Konzept als
eine brauchbare Konstruktion zum Verständnis
ökologischer Wechselbeziehungen erneut ins Spiel
gebracht. 2015 erschienen seine Vorträge zum Thema unter
dem Titel "Face à Gaïa. Huit conférences sur le nouveau
régime climatique" auf Französisch, 2020 bei Suhrkamp
unter dem Titel "Kampf um Gaia" auf Deutsch. Für Latour
ist der naturwissenschaftliche Begriff einer analytisch
zu erfassenden und technisch-wissenschaftlich zu
beherrschenden und zu gestaltenden Natur veraltet. Das
Gaia-Konzept eröffne ihm zufolge den Weg zu einem
interaktiven, dynamisch-integrativen Naturverständnis.
Sein Konzept bemüht sich um eine Vermittlung zwischen
den beiden extremen Ausformungen des Gaia-Konzeptes,
wonach Gaia entweder durch ihre Lebewesen für ihre
Selbstoptimierung sorge (die alte
romantisch-idealistische Konzeption -
Optimierungsmodell) oder aber als strafende Mutter über
negative Rückkopplungen (im Extremfall das Aussterben
einer Spezies oder ganzer Klassen) ihren Bestand
reguliert (homöostatisches Modell).
Lektüreempfehlung:
John Brockman, Die dritte Kultur. Das Weltbild der
modernen Naturwissenschaft, Wilhelm Goldmann Verlag 1996
|
|
Medea-Hypothese
Zu
Beginn des 21. Jahrhunderts entwickelte der
Paläontologe, Biologe und Geologe Peter Douglas Ward
(*1949) die Medea-Hypothese, wonach das Leben auf der
Erde prinzipiell selbst-destruktiv verfasst sei. Damit
bezog Ward dezidiert die Gegenposition zur
Lovelock-Margulisschen Gaia-Hypothese. Wards
Medea-Hypothese geht auch, wie die Gaia-Hypothese, von
einem Superorganismus aus, sieht dessen Praxis jedoch
nicht auf Selbsterhaltung, sondern auf Selbstzerstörung
ausgerichtet. Belege sieht er in der Methankrise vor 3,7
Milliarden Jahren, der Sauerstoffkatastrophe vor 2,5
Milliarden Jahren, zwei globalen Vergletscherungen vor
2,3 Milliarden und vor 790–630 Millionen Jahren und
mehreren Schwefelwasserstoffkatastrophen - jeweils
verbunden mit Massenaussterben höherer Lebensformen.
Die Grundlage für die Medea-Hypothese findet sich in
einer Publikation Wards von 2004, mit dem Titel
"Gorgon", benannt nach den Gorgonopsiden, einer
reptilienartigen Säugetiergruppe, die am Ende des Perm
einem der fünf großen Massensterben der Arten zum Opfer
fiel. Und deren Namen bereits (wie dann "Medea") auf die
griechische Mythologie verweist, die Gorgonen,
geflügelte Schreckgestalten. Allerdings wird für dieses
Massenaussterben ein externes Ereignis, ein
Asteroideneinschlag, verantwortlich gemacht. Von
"Selbstzerstörung" kann hier korrekterweise nicht die
Rede sein. Im Epilog von "Gorgon" heißt die
Nebenüberschrift "Are We Living on a Safe Planet?". Die
dort gegebene Antwort, ein großes Nein, vertritt die
Auffassung, dass wir es nur Zufällen verdanken, dass
dieser Planet schließlich uns als Menschheit
hervorgebracht habe. Mit einer erstaunlichen Wendung zu
einer Position, die eher Frank Wuketits zugeordnet wird:
"Mass extinctions are thus agents of evolutionary
novelty".
Der österreichische Biologe
Franz Wuketits hatte zehn Jahre vor "The
Medea-Hypothesis" schon vorweggenommen, was heute vom
breiten Publikum Ward zugeschrieben wird. Wuketits
schreibt unter dem Titel "Die Selbstzerstörung der Natur
- Evolution und die Abgründe des Lebens" über die
Bedeutung von Katastrophen für die Geschichte der
Biologie. Für Wuketits führte - im Anschluss an Darwin -
Zerstörung in der Natur zur Weiterentwicklung und
letztlich zum Menschen, sie hatte also eine konstitutive
Rolle für die Menschheit. Er führt auch aus, dass die
Zerstörung der Natur durch den Menschen im aktuellen
Zeitalter nur eine Ausprägung der naturimmanenten
Zerstörungspotentiale sei. Und dass die Zerstörung
notwendiges Korrelat neuer Schöpfungen sei. Der Mensch
sei "zum größten Katastrophenbeschleuniger in der Natur
geworden" und er zähle daher "wahrscheinlich (...) schon
heute zu den 'Auslaufmodellen' der Evolution" (Wuketits
1999/2002, S. 135).
Ward geht davon aus, dass
die meisten Massenaussterben nicht durch externen
Einfluss, also Asteroideneinschlag, oder Vulkanausbrüche
und ähnliche nicht-biologische Ursachen (die bei
Wuketits dominieren) bedingt wurden, sondern durch
biologische Effekte auf der Erde selbst, durch
"wildgewordene Mikroben" ("microbes gone wild" - Ward
2009, S. 82). Seine Kernthese lautet: "Habitability of
the Earth as been affected by the presence of life, but
the overall effect of life has been and will be to
reduce the longevity of the Earth as a habitable
planet." (Ward 2009, S. 35). Wards
provokativ-pessimistische Medea-Konzeption ist auch vor
dem Hintergrund der wirtschaftsliberalen Restauration um
die Jahrtausendwende zu verstehen, die Stellung unter
anderem gegen ökologisch begründete Regulierungen des
Wirtschaftslebens bezog, die, im schlichten Verständnis,
von einer letztlich dem Menschen wohlgesonnenen Natur
ausgehen.
Die Medea-Hypothese wurde
dann von Ward selbst nicht weiter entwickelt. Sein
gemeinsam mit Joe Kirschvink (dem "The Medea-Hypothesis"
gewidmet ist) publiziertes Werk, "A New History of Live"
von 2015, vermeidet weitgehend den Bezug zur
Gaia-Hypothese und ebenso den Anschluss an die eigene
Medea-Hypothese. Lediglich im letzten Kapitel, "Die
Zukunft des Lebens auf der Erde", wird "die
Medea-Hypothese von Koautor Ward" (Ward/Kirschvink 2016,
S. 488) kurz erwähnt, versehen mit der "letzten
Voraussage", die aus ihr ableitbar sei: "Aus dem
selbstmörderischen Gefängnis, das das Leben schlicht
durch seine Existenz schafft, gibt es nur einen Ausweg -
Intelligenz." Und diese Intelligenz könnte etwa dazu
führen, "dass unsere Spezies ihren Lebensraum zuerst auf
den Mars, dann auf die Asteroidengürtel und am Ende auf
andere Sterne erweitert" (ebd., S. 492). Jeder Ansatz zu
einer Teleologie, einer negativen wie einer positiven,
fehlt. Im Kern steht vielmehr die Aussage, dass wir aus
den Katastrophen der Vergangenheit lernen könnten,
künftige zu vermeiden oder diesen angemessen zu
begegnen. Da alle vergangenen Massenaussterben mit
massiven klimatischen Veränderungen verbunden waren,
sollten wir die aktuelle Klimaerwärmung auch als
ernsthafte Warnung annehmen (ebd., S. 15).
Lektüreempfehlungen: Franz
M. Wuketits, Die Selbstzerstörung der Natur - Evolution
und die Abgründe des Lebens, Patmos 1999 (zit.
Taschenbuchausgabe dtv 2002). Peter
Ward, The Medea-Hypothesis, Princeton University Press
2009. Peter Ward/Joe Kirschvink, Eine neue Geschichte
des Lebens, Pantheon 2016 (zuerst engl. 2015)
|
|
Naturdinge als
Rechtssubjekte
Ende der 1960er Jahre wollte die
Walt Disney Company im Sequoia Nationalpark, mitten im
Dreieck San Francisco-Los Angeles-Las Vegas gelegen, ein
Skiresort mit 22 Pisten anlegen - plus einer Autobahn
quer durch den Nationalpark. Die
Umweltschutzorganisation Sierra Club, gegründet 1892,
reichte beim Obersten Gerichtshof eine Klage ein, die
1972 abgelehnt wurde. Durch öffentlichen Druck wurde das
Projekt dennoch durch eine Kongressentscheidung 1978,
unter der Carter-Regierung, gestoppt.
Im
Kontext der Auseinandersetzung veröffentlichte der
nordamerikanische Philosoph und Jurist Christopher D.
Stone 1972 im "Southern California Law Review" den Essay
"Should Trees have Standing?". Darin geht er zunächst
allgemein von den sozialen Kosten wirtschaftlicher
Aktivitäten aus und fordert, "Every well-working
legal-economic system should be so structured as to
confront each of us with the full costs that our
activities are imposing on society" (Stone 1974, S. 27).
In mehreren Anläufen entfaltet er die Grundlagen dafür,
Naturdinge und Naturgegebenheiten als Rechtssubjekte
anzusehen, unter rechtlich-operationalen Aspekten sowie
unter psychologischen und sozialpsychologischen
Aspekten. Zum Ende seiner Erörterungen schließt er an
die Gaia-Hypothese Lovelocks an: "I do not think it too
remote that we may come to regard the Earth, as some
have suggested, as one organism, of which Mankind is a
functional part" (Stone 1974, S. 52).
Der Bundesrichter William O. Douglas griff Stones
Programm auf und führte in seinem Dissens zur
Klageentscheidung im gleichen Jahr unter anderem aus:
"Inanimate objects are sometimes parties in
litigation. A ship has a legal personality, a fiction
found useful for maritime purposes. The corporation
sole — a creature of ecclesiastical law — is an
acceptable adversary and large fortunes ride on its
cases. The ordinary corporation is a "person" for
purposes of the adjudicatory processes, whether it
represents proprietary, spiritual, aesthetic, or
charitable causes.
So it should be as respects valleys, alpine meadows,
rivers, lakes, estuaries, beaches, ridges, groves of
trees, swampland, or even air that feels the
destructive pressures of modern technology and
modern life. The river, for example, is the living
symbol of all the life it sustains or nourishes —
fish, aquatic insects, water ouzels, otter, fisher,
deer, elk, bear, and all other animals, including
man, who are dependent on it or who enjoy it for its
sight, its sound, or its life. The river as
plaintiff speaks for the ecological unit of life
that is part of it. Those people who have a
meaningful relation to that body of water — whether
it be a fisherman, a canoeist, a zoologist, or a
logger — must be able to speak for the values which
the river represents and which are threatened with
destruction."
(Stone 1974, S. 73ff)
Wir haben hier eine der ersten qualifizierten
zeitgenössischen Begründungen für die Behandlung von
Naturdingen als Rechtssubjekte vorliegen. Vorläufer
kennen wir aus Mittelalter und früher Neuzeit,
insofern bis ins 17. Jahrhundert hinein Tiere
verschiedenen Dokumenten zufolge als strafmündig
angesehen wurden. Der Historiker Peter Dinzelbacher,
spezialisiert auf die Erforschung des Mittelalters,
veröffentlichte 2006 die Untersuchung "Das fremde
Mittelalter. Gottesurteile und Tierprozesse". Damit
trug er das Thema ins allgemeine Bewußtsein,
insbesondere mit seinem gerne zitierten Beispiel der
Maikäferprozesse von Lausanne (1478/79). Allerdings
bestehen an der Ernsthaftigkeit dieser Prozesse
erhebliche Zweifel, unter anderem vorgetragen von der
Rechtshistorikerin Eva Schumann, die als ursprüngliche
Quelle solcher Berichte Schwänke und Anekdoten
annimmt, die das Genre der Fabel aufgreifen (Eva
Schumann: Tiere sind keine Sachen, in: Beiträge zum
Göttinger umwelthistorischen Kolloquium 2008-2009).
Der Ansatz von Stone und Douglas 1972 ist ein anderer.
Er geht nicht von Ähnlichkeiten und Verwandtschaften
in den Verhaltensweisen und Vermögen von Tieren und
Menschen aus, sondern von einer Wertschätzung, die
eher dem Sachenrecht entstammt. Dieser Ansatz tritt
aktuell zurück hinter dem Bestreben, Tiere und
Pflanzen, im Gaia-Ansatz gar den Planeten insgesamt,
als Rechtsubjekte im Ausgang von einer real
festgestellten oder unterstellten Fähigkeit zur
Empfindung und einer gesteuerten Reaktion auf die
Empfindung aufzufassen.
Lektüreempfehlung: Christopher D.
Stone, Should Trees Have Standig? Toward Legal Rights
for Natural Objects, Los Altos: Kaufmann, 1974
|
|
Paradise Engineering
Der utilitaristische Philosoph und Futurologe
David Pearce wurde bekannt als Mitbegründer der "World
Transhumanist Association", seit 2008 "Humanity+". In
einem Videostatement definiert er "transhumanism" als
"the idea that we can use technology to overcome our
biological limitations". Auf seiner Website
will er zeigen, "how biotechnology will eradicate
suffering in all sentient life". Der Zeithorizont ist
dabei sehr großzügig gewählt. In etwa 1000 Jahren, so
skizziert er in einem Vortrag 2008 ("The Reproductive
Revolution"), sei die Menschheit gentechnologisch so
weit entwickelt, dass es weder Leid noch Tod gebe, nur
immerwährendes Glücklichsein: "Suffering of any kind
will be biologically impossible."
Pearce sieht die Menschheit in der Pflicht, zunächst im
eigenen Verhalten, durch eine strikt vegane Lebensweise,
Leiden für die Tierwelt zu vermeiden. Darüber hinaus
aber sei die Menschheit ethisch verpflichtet, neben der
Abschaffung des Leidens für die Menschheit und durch die
Menschheit auch das inhärente Leiden in der fühlenden
Tierwelt umfassend zu beenden durch "Paradise
Engineering". Unter anderem sollen nach seiner
Auffassung Beutegreifer zu Vegetariern werden.
In "Compassionate Biology" führt Pearce aus, wie schon
zum Ende dieses Jahrhunderts ein "High-tech Jainism" für
die fühlende, sich sexuell reproduzierende Tierwelt
Leiden drastisch reduzieren könne, zu geringen Kosten.
Pro Spezies rechnet er mit gerade einmal 10.000 Dollar
um eine entsprechende genetische Veränderung
einzuschleußen in das Genom. Diese Veränderung könne
z.B. eine signifikant erhöhte Schmerztoleranz bewirken.
Weitere Eingriffe werden langfristig aus Beutegreifern
Vegetarier machen, davor könnten sie leidensmindernd mit
Kunstfleisch ernährt werden.
Pearce betreibt u.a. die Website
"www.paradise-engineering.com", die sein Manifest von
1995, "The Hedonistic Imperative. Heaven on Earth?"
präsentiert. Am Beginn von "The Molecular Biology of
Paradise", einer Bilderstrecke zum Text des Manifestes,
begegnet uns der utilitaristische Theologe, Physiker und
Chemiker Joseph Priestley (1733-1804) mit seinem Diktum
"Whatever was the beginning of this world, the end will
be glorious and paradisical, beyond what our imagination
can conceive". Damit schließt Pearce sich dem
eschatologischen religiösen Diskurs an, den wir etwa von
Edward Hicks und der Quäkerbewegung allgemein kennen. In
seinem Kapitel "Reprogramming Predators" wird
entsprechend Jesaja 11:6 zitiert: "And the wolf shall
dwell with the lamb".
Inzwischen werden die Pearceschen Ideen auch
gelegentlich in den Auseinandersetzungen zwischen PETA
und Jägerschaft zitiert.
|
|
Epochenschwelle Corona
Schon während der sogenannten "ersten Welle"
der Corona-Pandemie tauchte die Rede davon auf, nach
Corona sei nichts mehr wie vorher. Und dies aus ganz
unterschiedlichen Perspektiven. Der ehemalige
Media-Markt-Saturn-Chef Wolfgang Kirsch bezog sich auf
die Einkaufsgewohnheiten, die zeitgemäßer würden, der
italienische Philosoph Giorgio Agamben sah einen neuen
Totalitarismus aufziehen - um nur zwei bezeichnende
Beispiele zu nennen. Zunächst verhalten wurden dann auch
die Begriffe "Epochenbruch" und "Epochenschwelle"
eingebracht - und zügig als unangemessen oder im
Corona-Blick verengt kritisiert, so von Andreas
Reckwitz, der in der ZEIT am 10. Juni 2020 davon
schrieb, dass wir uns schon seit einigen Jahrzehnten in
einem Epochenumbruch befänden. Und zu erinnern ist etwa
daran, dass Bischof Karl Kardinal Lehmann schon zur
Jahresschlussandacht 2015 im Hohen Dom zu Mainz mit
Blick auf die Flüchtlingskrise und die Klimaerwärmung
die Frage stellte, ob wir an einer Epochenschwelle
stünden.
Mit der "zweiten Welle" kehren diese Begriffe nun (Stand
Dezember 2020) aufgefrischt und angesichts des zweiten
Lockdowns sowie weiterer hoch infektiöser
Virusmutationen nicht mehr so ohne weiteres negierbar
zurück. Dabei zeichnen sich drei Dimensionen ab, die
ihre Anwendung zu rechtfertigen scheinen. Zum einen
werden ideologische Kernbestände der liberalen
Marktwirtschaft in einem bislang unvorstellbaren Maße
erodiert. Wenn ernsthaft über öffentlich finanzierte
"Unternehmergehälter" diskutiert wird - und sei es
zunächst nur für Freiberufler und Kleingewerbe - ist der
Bereich dessen, was bislang über Subventionen,
Schutzzölle, Staatsaufträge und ähnliche Stützungsmittel
"unfrei" an der freien Wirtschaft war, definitiv
verlassen. Auch die massive Unterstützung eines
privatwirtschaftlich organisierten
Infrastrukturunternehmens wie der Lufthansa bringt
Verwerfungen, die der aktuell auffrischenden
Kapitalismuskritik ein fünftes Movens beschert - nach
Klimaerwärmung, internationalen Fluchtbewegungen,
Wassernotständen und Biodiversitätsschwund. Zum anderen
und mit der Kapitalismuskritik verbunden wird sich das
Verhältnis Individuum-Kollektiv verändern, wobei die
Perspektive denkbarer Entwicklungen von neuen
Totalitarismen bis hin zu neuen gesellschaftlichen
Freiräumen für Gruppen und Lebensstile weit offen ist.
Hier möchte ich noch einen dritten Prozess bedenken: Zu
erwartende, ja schon ablaufende Umstrukturierungen,
Neuformierungen in unseren gesellschaftlichen und
individuellen Naturverhältnissen.
Seit Jahren, verstärkt seit Beginn der Corona-Pandemie,
wird darauf hingewiesen, dass die Bedrängung der
Wildtiere in ihren natürlichen Lebensräumen und die
Zerstörung ihrer Lebensräume grundsätzlich den
Viren-Übergang von Tieren auf Menschen (Zoonosen)
begünstige - zumal in den zerstörten Lebensräumen häufig
Siedlungen entstehen. Regionen wie Südostasien und
Südamerika, in denen in besonderem Umfang seit Jahren
großflächig Wälder gerodet werden, bieten besonders
fatale Voraussetzungen für Epidemien und Pandemien auf
der Basis von Zoonosen (zu denen neben Corona auch HIV
und andere besonders bedrohliche Infektionskrankheiten
der jüngeren Zeit gehören). Wobei in Südostasien auch
noch der Verzehr virusbelasteter Wildtierarten zur
Risikoerhöhung hinzukommt. Mit der Lebensraumzerstörung
verbunden ist ein Rückgang der Biodiversität, was zum
Überleben und zur Ausbreitung einiger anpassungsfähiger
Generalisten führt, die als Virensammler fungieren und
gerade die besonders anpassungsfähigen Virenarten
verbreiten. Am 29. Oktober 2020 veröffentlichte der
UN-Weltbiodiversitätsrat IPBES die Ergebnisse seines
sommerlichen Workshops zu "Biodiversität und Pandemien".
Der Agroökologe, Biologe und Umweltforscher Josef
Settele hat mit seinem Buch "Die Triple Krise"
am 6.11.2020 eine hilfreiche Zusammenfassung der
bisherigen einschlägigen Forschungsergebnisse
veröffentlicht und Pandemien, Klimawandel und
Artensterben als drei Folgen des gleichen menschlichen
(Fehl-)Verhaltens eingeordnet: Folgen der weitgehend
uneingeschränkten Ausbeutung der Natur durch Politik,
Wirtschaft, Gesellschaft und kriminelle Strukturen.
Das große Versprechen des
naturwissenschaftlich-ökonomischen Naturumgangs
hieß: Sicherheit zu bieten gegenüber den
Unberechenbarkeiten der Naturprozesse, gegen die
elementaren Lebensbedrohungen durch Krankheit, Hunger
und Witterung. Alle drei Bedrohungen kehren nun in
beunruhigenden Ereignissen auf der Rückseite der
geleisteten Naturbeherrschung zurück, Krankheit in
Gestalt von Covid-19 u.a., Hunger als absehbare
strukturelle Folge des Biodiversitätsschwundes
(eingebunden in den Komplex der Degradation von Böden
sowie Wasserreservoires) und Witterung in den
Auswirkungen der Ressourcenverschwendung als
Klimaerwärmung durch Methan und CO2. Covid-19 kommt
dabei insofern eine besondere Funktion zu, als die
Folgen menschlichen Fehlverhaltens im Naturumgang nun
unmittelbar und individuell erlebbar auch in
wohlhabenden Ländern lebensbedrohend werden und darüber
hinaus Freiheit und Konsummöglichkeiten, die
Legitimationspfeiler der einschlägig noch dominierenden
Gesellschaftssysteme, erheblich einschränken. Eines der
wichtigsten Stichworte zum Verständnis des Umgangs mit
Covid-19 ist der Kontrollverlust. "Vor Corona kann man
nicht davonlaufen!" - Dies sagte die elfjährige Tochter
von Freunden 2020 zu mir. Und sie trifft damit den Kern
unseres Problems mit Covid-19. Ihre Position kindlicher
Demut desavouiert aufs Schärfste die Demonstration von
Allmachtsphantasien, die sich an Lockdown-Regelungen und
Impfstoffverteilungspläne klammern und die totale
Rückverfolgbarkeit der Infektionen zum Credo machen. Dem
gegenüber fordert der UN-Weltbiodiversitätsrat
Ursachenbekämpfung ein - und das heißt auch, die
Pandemie nicht nur mit den Prinzipien zu bekämpfen, die
sie mit verursacht haben.
Die Zukunft wird zeigen, ob die Antwort nun eine weitere
"Humanisierung" des Planeten im Sinne einer totalen
Zurichtung auf menschliche Bedürfnisse sein wird, mit
weiteren Ausrottungswellen zur (gezielten oder
beilaufenden) Reduktion der Grundlagen für Zoonosen,
oder eine substantielle Anerkennung der Humanität
begründenden und erhaltenden Leistung des
Naturhaushaltes und der Biodiversität insgesamt.
|
| ⇧ |